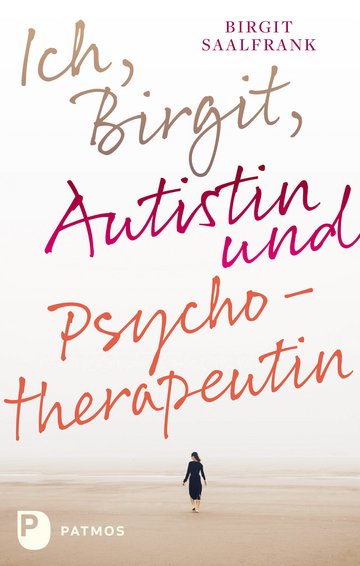Herkunft
Dass ich tatsächlich anders war als andere Menschen, war mir lange Zeit nicht wirklich bewusst. Das lag daran, dass ich Persönlichkeit als etwas ansah, was man bei sich selbst beliebig formen und gestalten kann. Der Satz »Ich kann, was ich will!« formte sich in mir schnell zu dem Glauben »Ich kann sein, wer ich will!«. Ich wusste nicht, dass jeder Mensch von Natur aus bestimmte Anlagen mitbringt, die seine Identität zu einem großen Teil determinieren. Meine Mutter hatte mir von früh an vermittelt, dass es wichtig sei, lustig und fröhlich zu sein, damit andere Menschen Interesse daran hätten, mit mir zusammen zu sein. Dieser Maxime, die meiner eigentlichen Persönlichkeit zutiefst widersprach, folgte ich über viele Jahre – in der Hoffnung, auf diese Weise endlich guten Kontakt zu anderen Menschen herstellen zu können. Durch dieses anhaltende Bemühen meinerseits, anders zu sein, als ich war, dauerte es auch so lange, bis ich schließlich im Alter von 39 Jahren als Asperger-Autistin diagnostiziert wurde.
Aber ich will von Anfang an erzählen.
Auf der Welt
Ich war das erste Kind meiner Eltern und kam an einem sonnigen Mittwoch im März 1971 in der Münchner Uniklinik auf die Welt – unterstützt von einer Saugglocke, da ich etwas schräg im Mutterleib lag. Direkt nach der Geburt erbrach ich alles, da ich wohl Fruchtwasser geschluckt hatte, und hatte Saugschwierigkeiten, also wurde ich die ersten sechs Tage künstlich ernährt. Gestillt worden bin ich nicht.
Gesprochen habe ich schon sehr früh, laufen gelernt jedoch erst im siebzehnten Lebensmonat. Das weiß ich so genau, weil meine Mutter in meinen ersten Lebensjahren für eine Forschungsstelle der Münchner Uniklinik meine Entwicklung genau protokolliert hat.
Meine Mutter bemühte sich von früh an darum, dass ich mit anderen Kindern spiele. Immer wieder setzte sie mich in den Sandkasten zu Gleichaltrigen, aber ich krabbelte immer zu ihr zurück. Sie tat das, so sagt sie heute, weil sie selbst als Kind nie mit Gleichaltrigen spielen durfte und sie ihre eigenen Kontaktschwierigkeiten darauf zurückführte. Mit drei Jahren kam ich in den Kindergarten, kurz nachdem wir von München nach Oberursel im Taunus, in die Nähe von Frankfurt am Main gezogen waren. Ich weinte nach Aussage meiner Mutter immer sehr lange, wenn sie mich morgens im Kindergarten abgab. Erinnerungen an die Kinder aus meiner Gruppe oder was ich dort gespielt hätte, habe ich nicht. Es gibt nur ein Mädchen, mit dem ich auch außerhalb des Kindergartens weiter befreundet war.
Vor einiger Zeit habe ich mit meiner Mutter sämtliche Fotos aus meiner Kinderzeit angeschaut. Dabei ist uns aufgefallen, dass ich bis zum Alter von etwa drei Jahren stets fröhlich und aufgeweckt auf den Bildern wirkte. Vom dritten oder vierten Lebensjahr an sehe ich jedoch fast immer ernst und verschlossen aus. Ob das nun an dem Umzug von München nach Oberursel lag, daran, dass ich nun in den Kindergarten ging oder an dem beginnenden Asperger-Syndrom, lässt sich im Nachhinein nur schwer beantworten.
Das große Ehebett meiner Eltern beziehungsweise genauer gesagt der Raum darunter war eine Schatzkiste für mich. Man konnte nämlich unter das Bett krabbeln, wo lauter interessante Sachen verstaut waren, zum Beispiel alte Schuhe oder auch die Stöckelschuhe meiner Mutter, über die ich mich schon als kleines Kind lustig gemacht habe, weil ich nicht verstand, wieso erwachsene Frauen so unpraktische Schuhe anzogen, in denen man kaum laufen konnte. Was ich auch sehr geliebt habe, war der Raum unterhalb des Arbeitstisches meiner Mutter im Elternschlafzimmer. Gelegentlich habe ich Decken über den Tisch gelegt und mir dort eine Höhle gebaut, in der ich mich gut geschützt aufhalten konnte.
Frühes Leid
Kurz vor meinem fünften Geburtstag, als meine Mutter mit meiner Schwester schwanger war, brachten mich meine Eltern zu einer Kinderpsychologin, die zunächst verschiedene Tests und Untersuchungen mit mir anstellte. Gründe dafür gab es mehrere: Ich litt unter Pavor Nocturnus, also nächtlichen angstvollen Schreianfällen, aus denen mich meine Eltern nur schwer aufwecken konnten. Ich hatte außerdem oft »Beinweh« als Kind: Die Waden schmerzten dann sehr unangenehm. Einmal wachte ich nachts auf und saß in der Badewanne, während meine Eltern besorgt um mich herumstanden. Sie dachten damals offensichtlich, dass ich vielleicht weinte, weil mir die Beine wehtaten, und setzten mich in die Wanne in der Hoffnung, dass mir das warme Wasser guttun würde. In dieser Zeit wurden bei mir öfters EEGs abgeleitet, da die Ärzte im Zusammenhang mit meinen nächtlichen Schreianfällen, die mit Verkrampfungen der Hände einhergingen, den Verdacht auf ein cerebrales Anfallsleiden hatten, der sich aber nicht bestätigte. Außerdem machte sich meine Mutter Sorgen, dass ich im Kindergarten mit den anderen Kindern nicht gut zurechtkommen würde. Diese Sorgen hat meine Kindergärtnerin laut dem Gutachten der Psychologin jedoch nicht geteilt, sie empfand mich weder als ängstlich noch als störend. Allerdings fand sie, dass ich noch lernen müsse, in Gruppen zu spielen und mich in diese zu integrieren. Wenn ich mit einem anderen Kind spielte, dann immer nur in der Eins-zu-eins-Situation, alles andere überforderte mich. Darüber hinaus habe ich bis zu meinem fünften Geburtstag noch ins Bett gemacht beziehungsweise hatte nach unserem Umzug nach Oberursel diesbezüglich einen Rückfall.
Ich war schon als Kind sehr geräuschempfindlich, hielt mir zum Beispiel immer die Ohren zu, wenn ein Zug vorbeifuhr. Außerdem hatte ich einige vokale Stereotypien, das heißt, ich wiederholte bestimmte Wörter oder Sätze, wo es nicht notwendig gewesen wäre. Wenn mir etwas gut gefiel, erkundigte ich mich beispielsweise bei meinen Eltern, ob wir das »immer mal wieder« machen würden und war erst beruhigt, wenn sie meine Frage bejahten. Als ich dann in die Schule kam, ging ich jeden Morgen mit dem an meine Mutter gerichteten Satz aus dem Haus: »Du bist da, wenn ich komme, sonst gehe ich zu Fichtes.« Meine Mutter musste mir dann versichern, dass sie mich verstanden hatte. Die Familie Fichte wohnte auch in unserer Spielstraße, sie hatten zwei Söhne in meinem Alter.
Die folgenden Angaben über meinen Entwicklungsstand und meine Auffälligkeiten habe ich dem Befundbericht der damaligen Psychologin entnommen, der mir vorliegt. Darin schreibt sie, dass sie bei mir eine »extravertierte Erlebnisrichtung« feststellt, was so gar nicht mit meinem rückblickenden Selbsterleben zusammenpasst. Mit Extraversion bezeichnet man eine nach außen gewandte Haltung und Aufgeschlossenheit gegenüber der Umwelt und anderen Menschen, während introvertierte Menschen eher auf sich selbst bezogen und mit ihrem Innenleben beschäftigt sind. Vielleicht zeigte sich dieses Extravertierte in der Untersuchungssituation aber auch nur deshalb, weil ich alleine mit einer erwachsenen Person sprach, die sich mir vermutlich freundlich zuwandte. Im Kontakt mit fremden beziehungsweise mehreren Kindern gleichzeitig (zum Beispiel im Kindergarten oder später in der Schule) verhielt ich mich meiner Erinnerung nach immer eher zurückhaltend, beobachtend und still.
Die Psychologin diagnostizierte außerdem starke Antriebsenergien, die sich noch inadäquat am eigenen Körper abreagieren würden (zum Beispiel Haare drehen), sowie weitere Stereotypien bezüglich des Sammelns und Hortens – ich sammelte unter anderem Bierdeckel, Postkarten, Schlümpfe und benutzte Eisverpackungen. Oftmals sprach ich kindisch und verhielt mich zwanghaft in Bezug auf das Schließen von offenen Schubladen oder ich strich umgelegte Teppichecken wieder gerade (das allerdings schon als Kleinkind in München). Mein Selbstbewusstsein war eher gering ausgeprägt, stellte die Psychologin fest.
Auf einem Bild malte ich mich ganz nah bei meiner Mutter und keine anderen Kinder dazu, was interpretiert wurde als nicht mehr ganz altersgemäße Orientierung in Richtung Mutter statt hin zu Gleichaltrigen. Das passt gut, ich glaube, ich war sehr auf meine Mutter bezogen. Erst im Lauf der Grundschuljahre gelang es mir, alleine bei meiner Freundin Martina zu übernachten. Ich hatte abends sonst Heimweh und meine Eltern mussten mich einige Male spätabends wieder abholen kommen.
Von der Psychologin danach gefragt, wen ich am meisten lieben würde, gab ich damals meinen Teddy an, d. h. keine Bezugsperson. Bei einem Test musste ich mehrere Sätze vervollständigen: Traurig und schlimm fand ich es demnach immer, wenn ich alleine zu Hause war – was komisch ist, da ich mich real nicht daran erinnern kann, dass meine Eltern mich je alleine zu Hause gelassen hätten. Auch meine Mutter bestreitet das; eine Ausnahme war höchstens, dass sie manchmal zum Einkaufen ging, wenn ich nachmittags schlief.
Die Psychologin mutmaßte, dass ich insgesamt unter Verlassenheitsgefühlen in der Familie litt und unter entsprechenden Wünschen nach Zuwendung, die eventuell zu stark seien. Den Satzanfang »In meiner Familie bin ich ...« hatte ich folgendermaßen vervollständigt: »... Gast, so wie wenn einer zu Besuch ist.«
Dann sollte ich einen Wunsch angeben, den ich gern erfüllt hätte. Das war für mich ein großer Plüschesel (den ich allerdings schon besaß). Schon als Kind hatte ich eine intensive Beziehung zu meinen Kuscheltieren, die aufgereiht neben mir im Bett schliefen und fast ein Drittel des Bettes einnahmen. Mit Puppen konnte ich nichts anfangen, auch mit Barbiepuppen nicht.
Im Anschluss an die Diagnostik nahm ich an insgesamt 35 Spieltherapiestunden teil, zusammen mit zwei anderen Mädchen in meinem Alter. Besondere...