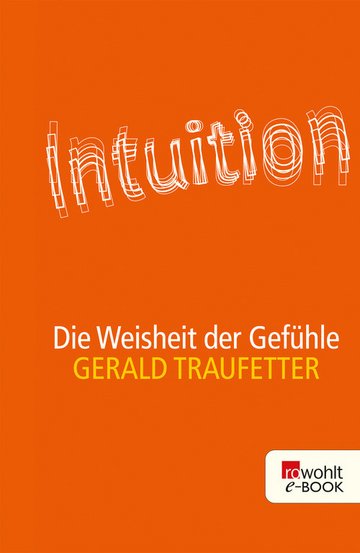Wenn die Urteilskraft verunglückt
Wie tickt wohl jemand, der sich nicht richtig entscheiden kann? Nicht, weil er einer dieser unentschlossenen Zeitgenossen ist, der im Restaurant nicht weiß, was er bestellen soll – und dann das Gericht nimmt, das der andere soeben beim Kellner geordert hat. Nein, hier geht es um jemanden, der gewissermaßen entscheidungskrank ist.
Vor meiner Ankunft in Leipzig hatte man mir am Telefon gesagt, ich solle aufpassen, wenn ich mit dem Patienten rede. Er könne leicht abschweifen. Er komme nie auf den Punkt. Geduld dürfe ich bei ihm nicht erwarten.
Als mir Maik dann aber in der Tagesklinik für kognitive Neurologie an der Universitätsklinik in Leipzig gegenübersitzt, fällt mir zunächst einmal auf, dass mir nichts auffällt. Maik, wie ich ihn nennen werde, weil er seinen richtigen Namen lieber nicht verraten möchte, ist 28 Jahre alt. Er hat dunkelbraune, leicht gelockte Haare. Seine Augen liegen tief. Und dennoch, er schaut treuherzig drein. Sogar ein wenig spitzbübisch. Vielleicht ist er ein wenig unsicher, denke ich, aber das kann auch daran liegen, dass es ihm unangenehm ist, einem Fremden seine Lebensgeschichte zu erzählen. Er beginnt sie mit dem Tag, als er nach seinem schweren Autounfall endlich das Rehabilitationszentrum in Bad Lausick verlassen durfte.
Damals schüttelte der Arzt ihm fröhlich die Hand. «Sie sind wieder vollkommen gesund», sagte der Neurologe mit einem zufriedenen Lächeln und fügte hinzu: «Glück haben Sie gehabt, großes Glück!» Häufig sind in der Klinik diese Momente des Abschieds voller Tragik. Der Patient wird mit seinem Leben entlassen, aber häufig mit nicht viel mehr. Er sitzt im Rollstuhl, kennt seine Eltern und sich selbst nicht. Der Mediziner weiß: Wer ihm noch «Vielen Dank» sagen kann und «Tschüs!», zählt hier zu denen, die es glimpflich getroffen hat.
Maik hätte auch einer jener jungen ostdeutschen Männer sein können, die mit ihrem Verkehrsverhalten deutliche Spuren in der statistischen Lebenserwartung hinterlassen. Das Auto, aus dem sie ihn herausgeschnitten hatten, war bizarr um einen Baum gewickelt. Auf dem Beifahrersitz hatte noch das von Bier triefende T-Shirt gelegen – der Auslöser für seine fatale Entscheidung, die er an diesem schönen Frühsommerabend des Jahres 1997 getroffen hatte. In der Gaststube seines Fußballclubs hatte er mit ein paar Kumpeln zusammengestanden und getrunken. Er wollte gar nicht mehr mit dem Auto fahren an diesem Abend. Deshalb hatte er ihre Einladung angenommen. Doch dann schüttete einer von ihnen aus Versehen Bier über Maiks T-Shirt. Deshalb musste er nochmal nach Hause fahren und ein sauberes Hemd holen. Schließlich hatte er einer Freundin versprochen, später mit ihr in die Disco zu gehen.
«Werde ich denn studieren können?», war Maiks letzte Frage an den Doktor. Der nickte. Die kognitiven Tests, die man mit ihm in den letzten Wochen gemacht hatte, zeigten zur Überraschung der Psychologen keine Auffälligkeiten. Unterhalb der Augen war von Maiks Gesicht zwar kaum mehr etwas heil geblieben. Den Kiefer hatte das Lenkrad vollkommen zertrümmert. Im Gehirn, das beim Unfall massiv beschleunigt und gegen die innere Stirn geprallt war, zeigten sich vor allem zwei Blutungen. Eine im Frontalhirn und die andere in der Amygdala. Und dennoch stellt sich heraus, dass Maik normal intelligent, in manchen Aufgaben sogar überdurchschnittlich ist. Das zeigen die vielen Tests, die sie mit ihm gemacht haben. «Grundfähigkeiten unauffällig» heißt das im Entlassungsbericht: «Kognitive Verarbeitung durchschnittlich» und an anderer Stelle: «Selektive Daueraufmerksamkeit überdurchschnittlich». So lautet der Befund aus der Klinik in Bad Lausick. «Nichts spricht gegen die Uni», sagte der Doktor also und wünschte alles Gute.
Aber es ist nicht alles gut geworden.
Nach seiner Entlassung entgleitet Maik die Kontrolle über sein Leben. Nach seinem Studium als Medientechniker in Leipzig hat er ein Praktikum nach dem anderen absolviert. Keiner wollte ihn anschließend übernehmen.
«Ich kann nicht sagen, dass ich dumm bin», verteidigt sich Maik.
Als er das sagt, fällt mir endlich auf, was mich unterschwellig wohl schon seit einigen Minuten beschäftigt. Es ist dieses seltsame Missverhältnis zwischen dem dramatischen Inhalt dessen, was er sagt, und seinem Verhalten dabei: völlig prosaisch, nüchtern und emotionslos. Er erzählt von seinem Scheitern, und es scheint ihm gar nichts auszumachen. Er hört sich an wie ein Nachrichtensprecher, der die Meldung zu seinem verkorksten Leben vorliest. Bin ich möglicherweise betroffener über das, was Maik berichtet, als er selber es ist?
«Mich hat das alles nicht beunruhigt», höre ich ihn sagen. Er habe sich als Webdesigner selbständig gemacht. Ohne Erfolg. Das war in der Boomphase der New Economy. «Ich sah, wie meine Kommilitonen an mir vorbeizogen. Sie waren erfolgreich, hatten eine Freundin, gründeten Familien», erzählt Maik. «Ich dachte eben, die sind besser als ich.» Er zuckt mit den Schultern und schaut ein wenig ratlos unter seinen buschigen Augenbrauen hervor. Seit vier Jahren ist er nun arbeitslos, und wie im Laufrad schließt sich eine Fortbildung an die andere an. Maiks Mutter war es, der die seltsamen Veränderungen ihres Sohnes seit dem Unfall aufgefallen waren. Sie waren subtil, aber nicht subtil genug, dass sie einer Mutter unbemerkt bleiben könnten. Maik erschien ihr sonderbar teilnahmslos. Er kann über Gefühle reden, aber nur sachlich. Kümmern tun sie ihn nicht wirklich. Bestimmte Erlebnisse lassen sie immer wieder über das Verhalten ihres Sohnes grübeln. Ihr Mann, der ein kleines Bauunternehmen besitzt, ist wütend, weil Maik einen Presslufthammer im Regen hat liegenlassen. Statt sich zu entschuldigen, macht Maik einen Witz: Der Vater könne das Gerät ja trocken föhnen, und er kommt sich dabei sehr witzig vor. So unsensibel, so provozierend war ihr Sohn doch früher nicht, und sie fühlt, dass er auch nicht absichtlich seinen Vater in Rage bringen will. Maiks Mutter ist verzweifelt. Ihr Sohn sitzt jetzt nur noch daheim, wenn er nicht gerade zum Surfen an den See in einer alten Braunkohlengrube fährt. Sie ist froh, dass er sich die viele Zeit ein wenig vertreibt. Dann bittet sie ihren Sohn, ihr eine eigene Webseite zu gestalten. Mit frischem Eifer setzt er sich an die Arbeit, schaut sich eine Internetseite nach der anderen an. «Um sich inspirieren zu lassen», wie er sagt. Inzwischen sind Monate vergangen, und die Webpräsentation seiner Mutter ist immer noch nicht online.
Bei solchen Worten horcht Yves von Cramon auf. Er ist ein erfahrener Neurologe, ein Spezialist. Der Direktor am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig hat viele psychisch veränderte Menschen gesehen. Die einen sind auf den ersten Blick sonderbar, die anderen erst, nachdem er sie eingehend untersucht hat. Da gab es den Gymnasiallehrer, der vollkommen normal erschien. Bis er ihm eine Aufgabe stellte: «Planen Sie Ihr Wochenende!» Das ist ein Test für vorausschauende Planung, eine hohe kognitive Leistung und gar nicht so selbstverständlich, wie sich bei dem Akademiker aus München herausstellte. Er stand auf, sagte: «Ich will meine Tante in Erlangen besuchen», und ging ohne Geld und Gepäck einfach zum Bahnhof. Oder der pensionierte Firmenchef, der nach einem Schlaganfall im Rollstuhl sitzen musste. Stundenlang erörterte Cramon mit ihm das Warum und Weshalb seiner Behinderung. «Sie haben recht, ich kann nicht mehr laufen», sagte der alte Mann ihm, stand im nächsten Moment auf und fiel der Länge nach hin. Und das tat er nicht das eine Mal, sondern immer wieder. Häufig wird Cramon auch als Gutachter herangezogen. «Da landen scheinbar völlig normale, gebildete und bislang völlig unbescholtene Menschen vor dem Sozialgericht, weil sie gegen eine Bestimmung verstoßen haben», sagt er. «Niemand kommt bei denen auf den Gedanken, dass ihr Fehlverhalten aus einem ganz konkreten, physiologischen Schaden im Gehirn resultiert.»
Spricht er von seinen Patienten, schwingt viel Fürsorge und Nachsicht in seinen Worten. «Alle geistigen Krankheiten, alles Verhalten, das von der sogenannten Norm abweicht oder das wir als kriminell bezeichnen, hat seine Ursachen im Gehirn, und wenn wir sie heute nicht finden, dann heißt das nur, dass wir noch nicht in der Lage dazu sind.»
Autorenporträt aus dem funktionellen Kernspintomographen (Life&Brain Center, Universität Bonn)
Bildgebende Verfahren: Der Blick in die Black Box
Wenn in diesem Buch von bildgebenden Verfahren die Rede ist, verbirgt sich dahinter zumeist die funktionielle Kernspintomographie. Sie ist ein hochmodernes Verfahren, das erst seit den 1990er Jahren existiert. Der Patient, beziehungsweise der Proband, liegt in einer engen Röhre. Sein Körper wird von starken Magnetwellen durchdrungen, die ein dreidimensionales Bild vom Inneren seiner Weichteile liefern. Funktionell bezeichnet dabei eine Eigenschaft, die insbesondere für die Neuropsychologie von großem Interesse ist: Auf dem Tomographenbild zeichnen sich jene Stellen im Gehirn ab, in denen viel Sauerstoff umgesetzt wird. Das lässt Rückschlüsse zu, welche Hirnregion bei einer bestimmten Aufgabe, die dem Versuchskandidaten auf einem Kopfhörer oder einem Monitor vorgespielt wird, aktiv ist. Das Verfahren ist ungefährlich, weil es ohne Röntgenstrahlen auskommt. Diese Strahlung verwenden Computertomographen. Auch diese, bereits in den 1970er Jahren entwickelte Technik liefert Schnittbilder vom Körper und findet, weil die Geräte nicht so teuer wie funktionelle...