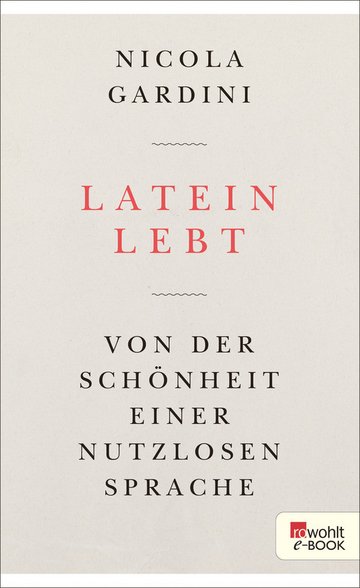1. Ein Haus
Nicht ohne Eitelkeit hatte ich zu jener Zeit mit dem methodischen Studium des Latein begonnen.
Jorge Luis Borges
Wie entsteht die Liebe zu einer Sprache? Um genau zu sein, die Liebe zum Latein?
Ich habe bereits als Kind mein Herz ans Latein verloren, und bis heute kann ich nicht sicher sagen, warum. Wenn ich darüber nachdenke, kommt mir höchstens die eine oder andere bruchstückhafte Erinnerung in den Sinn, die aber kaum als Begründung ausreicht. Wie lässt sich ein Instinkt, eine Berufung erklären? Am besten erzähle ich eine Geschichte.
Latein hat mir geholfen, mich von meiner Familie zu lösen, den Weg zur Poesie und zum literarischen Schreiben zu finden, im Studium voranzukommen, mich fürs Übersetzen zu begeistern, meine vielfältigen Interessen auf ein gemeinsames Ziel hin auszurichten und schließlich auch, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich habe Latein an der New School in New York, am Gymnasium Verri in Lodi und am Gymnasium Manzoni in Mailand unterrichtet, und auch heute noch, als Dozent für die Literatur der Renaissance in Oxford, benutze ich es Tag für Tag, denn ohne Latein keine Renaissance. In meiner Jugend wurde es mir zum Amulett und zu einem magischen Schild, ein wenig wie bei Julien Sorel, dem Protagonisten aus Stendhals Rot und Schwarz. In den Häusern reicher Freunde wurde ich vor allem deshalb akzeptiert, weil alle wussten, dass ich gut in Latein war. Auch als ich direkt nach meinem Hochschulabschluss in Altphilologie meine Promotion in Komparatistik an der New York University begann, waren es von Anfang an meine Lateinkenntnisse, die von den amerikanischen Professoren besonders geschätzt wurden. Erst dort, in dieser Welt des amerikanischen Geistes, in der die Persönlichkeit mehr zählt als das Elternhaus, wurde mir wirklich klar, welch großes Glück ich hatte. Dank Latein war ich nie allein. Mein Leben hat sich um Jahrhunderte verlängert und über mehrere Kontinente ausgedehnt.
Das Studium der lateinischen Sprache hat mir vom ersten Moment an beigebracht, auch meine eigene Sprache als Silben und leise Töne wahrzunehmen. Es hat mich gelehrt, wie wichtig die Musik der Worte ist – die ureigene Seele der Poesie. Die Wörter, die ich seit jeher benutzt hatte, begannen sich mit einem Mal in meinem Kopf in ihre Einzelteile aufzulösen und wie Blütenblätter im Wind durcheinanderzuwirbeln. Dank Latein wog ein italienisches Wort plötzlich mindestens ein Zweifaches. Unter dem blühenden Garten der Alltagssprache wucherte das Wurzelwerk der Antike. Zu entdecken (ich erinnere mich noch lebhaft an jenen Oktobermorgen in meinem ersten Jahr Latein), dass «giorno» und «dì», die italienischen Synonyme für «Tag», miteinander verwandt sind, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so scheinen mag, zu erfahren, dass ebenjenes «giorno» sich aus diurnus – dem Adjektiv zum lateinischen dies («Tag») – ableitet, von dem wiederum «dì» abstammt: Es war, als hätte ich eine geheime Tür entdeckt, als könnte ich mit einem Mal durch Wände gehen … Und kaum war ich auf der anderen Seite angelangt, sah ich auch schon, dass «oggi» («heute») etwas mit «giorno» und «diurno», mit dem lateinischen dies also, zu tun hatte: Es lässt sich in der Tat auf hodie zurückführen, das sich aus ho (einer Form des Demonstrativpronomens hic, «dieser») und die zusammensetzt und somit wörtlich «an diesem Tag» bedeutet. Ähnliches schien für den Namen des Göttervaters selbst zu gelten, für «Jupiter», den Dies-piter, wie er zum Beispiel in den Oden des Horaz (Carmina I, 34, 5) zu finden ist: den «Vater des Tages» – wobei im Übrigen lateinisch dies etymologisch verwandt ist mit Zeus. Einmal erkannt, erlaubte mir diese unscheinbare Wurzel di- ebendieses Alltägliche mit der Mythologie, die Gegenwart mit der archaischsten und heiligsten Antike zu verweben. (Nein, so leid es mir tut, das englische «day» ist kein direkter Verwandter, sondern ein Paradebeispiel einer irreführenden Ähnlichkeit. Wie übrigens etliche «falsche Freunde» – denken wir nur an das aus lateinisch calidus entstandene italienische «caldo», «warm», das nicht das Geringste mit dem aus dem Germanischen stammenden «kalt» zu tun hat.)
Natürlich verlangte dieser Zuwachs an Bedeutungen auf der einen Seite Präzision, geschichtliches Verständnis und Glaube an den verborgenen Sinn, an die Macht der Etymologie, doch verhalf er mir gleichzeitig dazu, mich an die tückischen Zwischentöne, an den Glanz der Bilder und damit auch an die Mehrdeutigkeit, an die Verschwommenheit, an die Aureole zu gewöhnen, daran, zwei oder gar drei Dinge in einem zu sagen. Das war es, das Ideal, das mir, wenngleich noch etwas schemenhaft, bereits vorschwebte, während ich noch die Schulbank drückte: in einer glasklaren und zugleich doch «abgründigen» Sprache zu schreiben.
Schon in meiner Kindheit übte Latein eine ungeheure Anziehungskraft auf mich aus, stammte es doch aus der Antike, die es mir von klein auf angetan hatte. Vor allem waren es bestimmte Vorstellungen von Antike wie die Pyramiden, die Säulen der griechischen Tempel oder die Mumien des Ägyptischen Museums in Turin, das wir während eines Schulausflugs besucht hatten, die mir regelrecht Herzklopfen verursachten. Ich kann mich noch gut erinnern, dass in meinem Lesebuch in der dritten Klasse von domus, den Stadthäusern der Patrizier, und insulae, den Wohnungen des gewöhnlichen Volkes, die Rede war. Meine Familie und ich, wurde mir klar, wohnten also in einer insula.
Ein richtiges Lateinbuch hielt ich allerdings erstmals in der siebten Klasse in der Hand. Dort wurde die Bauweise der domus ausführlich beschrieben. So lernte ich auch den einen oder anderen architektonischen Begriff, meine ersten lateinischen Vokabeln: impluvium, atrium, triclinium, tablinum, vestibulum, fauces (damals wusste ich noch nicht, dass diese Terminologie einem der einflussreichsten Werke der Architekturgeschichte, den Büchern Vitruvs, entstammte). Was für ein unglaubliches Haus, das den Regen durch ein Loch im Dach fallen ließ und in einem Becken sammelte, das Säulengänge und Zimmer über Zimmer hatte, ein Haus, in dem einen niemand finden konnte, so weitläufig war es! Voilà: Latein zu lernen wurde für mich gleichbedeutend mit der Sehnsucht nach sozialem Aufstieg, mit dem Traum von einem großartigen Haus. Genauer gesagt: Latein wurde in meiner Phantasie zu einem Raum, in dem es sich voller Glück leben ließ, es wurde der Raum des Glücks überhaupt. Und dieser Raum befand sich nicht nur in meinem Inneren: Unbezähmbar drängte er als Zeichnung nach draußen, überall malte ich – unter den konsternierten Blicken meiner Familie (die mein Verhalten rechtfertigte, indem sie sich sagte, dass ich eines Tages wohl Architekt werden würde) – Grundrisse diverser domus auf, und versah jedes Feld mit dem passenden Begriff seiner Bestimmung, und ich war sicher, dass auch ich eines Tages wahrhaftig meine eigene domus haben würde.
Genau im Jahr 1977, als ich aufs Gymnasium kam, war Latein als Pflichtfach abgeschafft worden. Unsere tüchtige Lehrerin, Signora Zanframundo, hatte – wohl eher aus Gewohnheit denn aus Treue – nach wie vor ein knappes Stündchen für Latein reserviert, verlangte den Schülern aber kaum noch etwas ab. Ich brachte mir die erste und zweite Deklination selbst bei, einzig aus Begeisterung, ohne mich jedoch allzu sehr darum zu bemühen, die logische Funktion der verschiedenen Endungen zu verstehen. Aber welch Glück, allein schon die Bezeichnungen der Fälle zu kennen: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, Vokativ, Ablativ!
Noch etwas anderes beflügelte meine Phantasie, wenn ich heute darüber nachdenke: das Vorbild meiner Mutter. Im Grunde kann ich sagen, dass ich Latein schon ehe ich direkt damit in Kontakt kam, wenn auch nicht als Muttersprache (wie im Falle Montaignes, der es nach seinen eigenen Worten noch vor dem Französischen sprach), so doch als vertrauten Klang empfunden hatte. Als Mädchen hatte meine Mutter, bevor sie nach Deutschland ging, einige Zeit bei den Nonnen von Aquila in den Abruzzen verbracht, wo sie auch das eine oder andere lateinische Gebet gelernt hatte – das Requiem aeternam (von dem ich während meiner ganzen Kindheit glaubte, es würde «requie meterna» geschrieben), das Pater noster, das Ave Maria … Mehr brauchte ich nicht, um zur Überzeugung zu gelangen, sie sei des Lateinischen mächtig. Sie selbst indes erhob niemals den Anspruch, Latein zu können, sondern beharrte im Gegenteil darauf, es nicht zu verstehen. Nicht anders als ihre Freundinnen, meinte sie, habe sie nur wie ein Papagei das nachzuplappern gelernt, was sie Tag für Tag morgens und abends im Gottesdienst gehört habe, und Gott allein wisse, wie viele versehentliche Flüche ihr dabei über die Lippen gegangen seien! («Die Ungebildeten», darauf macht uns auch Gian Luigi Beccaria aufmerksam, «haben das Latein der Messe stets falsch verstanden. Priester eingeschlossen.») Was mich betraf, musste sie allerdings auch nicht mehr können als dieses papageienhafte Herunterbeten; so unverständlich und deformiert es auch sein mochte, für mich war sie die Lateinexpertin. Dank dieser bizarren Klänge wurde sie in meinen Augen zur großartigen Mutter des ebenso großartigen Hauses, das ich nach und nach mit den einfachen Worten Vitruvs errichten würde.
Richtig gelernt habe...