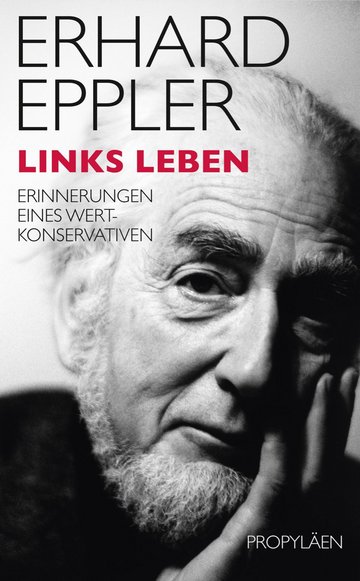Mein Weg zum Politiker
Angekommen in der Bundesrepublik
Über Jahrhunderte gab es in Württemberg nur eine Universität: die Eberhard Karls Universität in Tübingen. Sie war das geistige Zentrum des Landes. Noch bis ins 20. Jahrhundert dominierten die philosophische und die theologische Fakultät, die natürlich evangelisch war wie die Landeskirche. Erst als Napoleons Diplomaten das Ländle fast doppelt so groß und sogar zum Königreich gemacht hatten, war jeder dritte Einwohner ein Katholik. Also gab es in Tübingen auch eine katholische Fakultät.
Tübingen blieb eine Kleinstadt, in der Professoren und Weingärtner – die man »Gôgen« nannte – streng getrennt voneinander lebten, die Gôgen in der Unterstadt, zu der man tatsächlich hinuntergehen musste, die Professoren an jenem Südhang des Neckartals, an dem auch der Wein gedieh, über dessen Qualität man sich mit den Reutlingern – auch seit Jahrhunderten – stritt. Bis heute sind in Tübingen die Verbindungshäuser zu bewundern, die meist zwischen 1871 und 1914 der Bedeutung ihrer – schlagenden oder nicht-schlagenden – Verbindungen gerecht werden wollten. Dort wurden dann die berühmten »Gôgenwitze« erzählt, die bis heute zur Tübinger Lokalkultur gehören.
Wer in Württemberg in den Schuldienst wollte, tat gut daran, sein Studium in Tübingen abzuschließen. Das galt auch 1949, als die kleine Universitätsstadt zudem die Ehre hatte, als Hauptstadt jenes französisch besetzten Bundeslandes »Südwürttemberg-Hohenzollern« zu firmieren, das Carlo Schmid, in dessen Haus in der Goethestraße ich häufig zu Gast war, sein »Zaunkönigreich« nannte. Die Professoren der Germanistik oder Anglistik waren 1949 zum guten Teil noch dieselben wie vor 1945. Und ihre Vorlesungen über den Minnesang oder die deutsche Romantik waren auch noch dieselben: nicht anstößig, solide, aber auch nicht mitreißend. Dass zwischen 1933 und 1949 einiges geschehen war, ließ sich allenfalls aus den Vorlesungen des Politologen Theodor Eschenburg oder manchmal aus denen des Philosophen und Pädagogen Eduard Spranger entnehmen. Der Einzige, der jedoch wirklich darauf einging, war ein Gastprofessor italienischer Herkunft, Romano Guardini, ein katholischer Theologe.
Hier ist nicht der Ort, über ein Studentenleben zu berichten, in welchem entlassene Soldaten und Offiziere dominierten, auch nicht über die Vorbereitung auf die Examina oder die Dissertation im Fach Anglistik, deren Originalität zugleich ihre Stärke und ihre Schwäche war. Wichtiger ist mein Einstand in die neu entstehende Bundesrepublik, die 1949 geboren wurde. Und wichtig ist das, was mich dann so gründlich vom Studium abgelenkt hat, dass ich heute nicht mehr so richtig weiß, wie ich trotzdem durch die Examina kam.
Im Herbst 1949 begann der neue Bundespräsident Theodor Heuss seine Besuche in den Hauptstädten der Bundesländer. Wahrscheinlich hat er mit Tübingen begonnen, denn das war für ihn ein Heimspiel. Ich gehörte zu den nicht ganz wenigen Studenten, die ihn kennenlernen wollten. Mir hatte schon während des Krieges meine Ulmer Großmutter von den Heussens erzählt, die der Großvater im Kreis der Naumannfreunde kennengelernt hatte. Allerdings hatte die Großmutter vor allem von Elisabeth »Elly« Heuss-Knapp geschwärmt, einer sehr frühen Feministin, die sie für bedeutender als ihren Gatten hielt. 1949 war in Deutschland eine Bundespräsidentin noch nicht denkbar. Man hatte sich mit dem Ehemann begnügt. Wer war dieser Heuss, dem die Deutschen nördlich des Mains sein Pfarrhausschwäbisch lächelnd oder spottend durchgehen ließen, der also aus einem ähnlichen Stall kam wie ich?
Wahrscheinlich hat er an diesem warmen Herbsttag irgendwo eine lange Rede gehalten, zu der nur die Honoratioren eingeladen waren. Ich sah ihn erst, als wir Studenten am Nachmittag versuchten, ihn, der im Rathaus vom Oberbürgermeister gebührend empfangen wurde, immer wieder herauszulocken auf die kleine Empore, von der aus die Stadtväter sich an Festtagen an ihre Bürgerinnen und Bürger wandten. Unsere Sprechchöre blieben nicht ungehört. Er kam schließlich heraus, sagte uns ein paar freundliche Worte – und verschwand wieder. Das reichte uns nicht, so dass er seinen Auftritt mehrmals wiederholen und endlich sogar ein paar Worte über die neue Republik sagen musste. Schließlich begann es dunkel zu werden. Noch einmal kam der neue Präsident auf die Empore hinaus, und in unsere erwartungsvolle Gespanntheit hinein sagte er: »So, Leut, jetz isch gnuag. Jetz ganget ihr hoim!«
Das sind die einzigen Präsidentenworte, die ich bis heute nicht vergessen habe: Sie kamen langsam, wie alles bei Heuss. Dazu die tiefe Stimme, der väterliche Rat im heimeligen Dialekt, das ganz und gar Unpathetische. Gab es einen schöneren Kontrast zu dem marktschreierischen Pathos der Nazis?
War ich in Bern, wenn man so will, intellektuell zum Demokraten geworden, so wurde ich es an jenem Abend nicht nur im Kopf, sondern auch emotional, im Bauch: Ich wurde zum bewussten Bürger der Bundesrepublik Deutschland, zum deutschen Demokraten.
Weniger heimelig ging es zu bei Carlo Schmid. Der Sohn eines schwäbischen Vaters und einer französischen Mutter, der die Sprache seiner Mutter nicht weniger beherrschte als das Deutsche, lud damals immer wieder Studenten zu sich ein. War Theodor Heuss zu diesem Zeitpunkt noch gertenschlank wie die meisten Deutschen, so glich Carlo körperlich einem Koloss. Stark war auch seine Stimme. Er konnte zwar gut ins Schwäbische umschalten, aber meist sprach er ein perfektes Bühnendeutsch. Was ihn mir sympathisch machte, war nicht so sehr seine Bildung – er war wohl der letzte Politiker, der über Hölderlin oder Ovid genauso reden konnte wie über die Philosophen des 17. Jahrhunderts oder die moderne französische Literatur. Interessanter noch als der brillante Carlo wurde für mich der selbstkritische. Er war gleich nach dem Krieg der SPD beigetreten, weil er, der Starjurist und bürgerliche Intellektuelle – zu seiner Zeit keine unübliche Haltung –, sich in der Weimarer Republik zu fein gewesen war für das Geschäft der Politik. Hätten er und seinesgleichen sich um das kräftezehrende Geschäft demokratischer Politik gekümmert, so meinte er, wäre nicht nur Deutschland einiges erspart geblieben. Und nun war er Sozialdemokrat geworden. Meines Respekts konnte er sich sicher sein.
Gut verstand ich mich auch mit Carlos damaliger Frau. Wenn ich mein Fahrrad die stark ansteigende Goethestraße hinaufschob – Gangschaltungen waren damals unbekannt –, konnte sie mich aus dem Küchenfenster heraus einladen zu einem Schwatz am Küchentisch. Meine ersten Einblicke in die Innereien der Sozialdemokratie verdanke ich ihr. Da war ich noch gar nicht Mitglied.
Carlo Schmid gehörte bis zu seinem Tod 1979 zu den Politikern, die meinen Weg wohlwollend begleiteten. Immer wieder Vizepräsident des Bundestages, war er wohl der einzige aktive Politiker, dem man rasch anspürte, dass Politik zwar seine Pflicht als demokratischer Staatsbürger, nicht aber seine Leidenschaft war, politisches Gezänk und parteipolitische Enge nervten ihn. Zuerst war er Wissenschaftler, Rechtsgelehrter, dann war er Ästhet, in allen Künsten bewandert, besonders in der Literatur. Dabei war er Europäer, gewissermaßen von Geburt, in der französischen Geistesgeschichte nicht weniger zu Hause als in der deutschen.
Als Gustav Heinemann, den ich übrigens 1948 kennengelernt hatte, mir im Wahljahr 1953 einmal auftragen sollte, Carlo Schmid etwas auszurichten, was ich für bedeutsam hielt, fühlte ich mich ziemlich wichtig. Als ich an seiner Haustür klingelte, war Carlo gerade im Aufbruch zum Vortrag eines Hölderlinforschers. Ich könne ihn ja dorthin begleiten. Das tat ich gerne. Aber ich kam gar nicht zu Wort. Er war schon ganz bei Hölderlin und hielt mir seinerseits einen Vortrag über die späten Jahre des kranken Dichters in seinem Turm am Neckarufer. Erst unter der Tür zum Versammlungslokal wurde ich meine Botschaft los, die er ziemlich ungerührt zur Kenntnis nahm: Er hielt nichts von Heinemanns Partei. Sie war nicht notwendig. Und nur was politisch absolut notwendig war, rechtfertigte politisches Engagement.
Wahrscheinlich war auch sein politischer Ehrgeiz begrenzt. Während manche Bildungsbürger von einem Bundeskanzler Carlo Schmid träumten, schien Carlo denen in der Partei nicht allzu böse, die fanden, er eigne sich zwar für repräsentative Ämter wie die des Bundestagspräsidenten oder gar des Bundespräsidenten, nicht aber für die 80-Stunden-Woche eines Bundeskanzlers. Gegen einen Bundespräsidenten Schmid sprach damals allerdings etwas, das wir heute kaum noch verstehen. Während Präsident Gauck auch bei offiziellen Anlässen von seiner »Lebensgefährtin« begleitet wird, war vor einem halben Jahrhundert ein geschiedener Bundespräsident nicht denkbar. Und Carlo hatte sich von seiner Jugendliebe Lydia scheiden lassen.
1968 und im Folgejahr saßen wir beide, Carlo Schmid und ich, um den ovalen Tisch des Palais Schaumburg in der Regierung der ersten Großen Koalition und lauschten der tour d’horizon des Kanzlers Kurt Georg Kiesinger, mit der jede Sitzung begann. Für Carlo hatte man ein selbständiges Bundesratsministerium erfunden, weil die Sozialdemokraten nicht gut ohne ihren populären Bildungsbürger in eine Regierung gehen konnten. Für die Arbeit hatte man ihm einen fleißigen Staatssekretär mitgegeben, den Tübinger Abgeordneten Fritz Schäfer. Denn Carlo war vollauf beschäftigt mit einer Malraux-Übersetzung, von der er auch auf der Regierungsbank nicht abließ. Kein Wunder, dass der 72-Jährige manchmal...