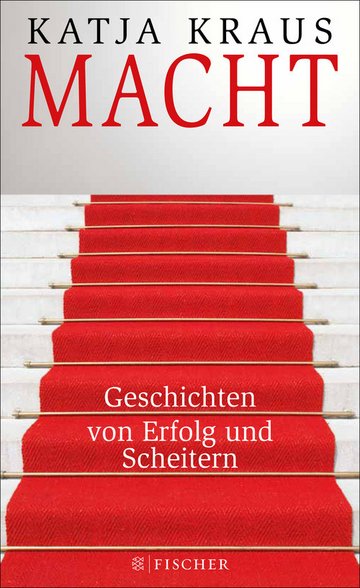Der Antrieb
»Wenn ich alles richtig mache, bin ich vorn.«
Sven Hannawald
Bei der Bestellung der zweiten Portion Pommes frites in einem Hamburger Nobelhotel gelingt es ihm nicht mehr, die Ausschweifung unkommentiert zu lassen. Zu lange schon ist sich Sven Hannawald der aufmerksamen Beobachtung seiner Essgewohnheiten bewusst. Wenn er über das Thema spricht, das ihn in seiner Karriere so konsequent begleitete wie die Vierschanzentournee, schleicht sich ein Schatten in sein strahlendes Jedermanns-Lieblingsgesicht. Dass die professionelle Umsicht in seinem Essverhalten als Magersucht missverstanden wurde, hat ihn immer irritiert und geärgert. Euphorisch wurde er für seinen historischen Triumph gefeiert, als er als erster Springer alle vier Wettbewerbe einer Tournee gewann. Dass manche Menschen semantisch nicht unterscheiden können zwischen dem Gesamtsieger der Vierschanzentournee, den es in jedem Jahr gibt, und seinem einzigartigen Erfolg, kränkt ihn. Schließlich ist es das, »was am Ende stehenbleibt, wofür man all das macht«. Oder eben Selbstverständliches nicht macht. Wie essen. Jetzt, da lange schon nicht mehr jedes Gramm weniger an seinem Körper die Sprungweite erhöht, die am Ende über seinen Seelenfrieden entscheidet, empfindet er Erleichterung. Es ist diese Sehnsucht nach der inneren Zufriedenheit, nach der Erfüllung des eigenen Anspruchs, die ihn zu einem Superstar gemacht hat. Und zum Getriebenen. Für Athleten sind Erfolg und Misserfolg am unmittelbarsten messbar. Gewinnen oder verlieren, Held oder Versager unterscheidet sich in Hundertstelsekunden, Millimetern oder eben Gramm.
Das Gespräch mit Sven Hannawald ist mir durch meine eigene Zeit als Fußballtorhüterin auf eine besondere Weise vertraut. Es gibt ein intimes Verständnis zwischen Sportlern, insbesondere denjenigen, die für ihre Leistung allein aus sich heraus Verantwortung tragen. Die keine äußeren Umstände als Erklärung finden für den zu kurzen Sprung oder das haltbare Gegentor. Die Offensichtlichkeit jeder Blöße ist Antrieb und Bedrohung zugleich. Die Überzeugung: »Wenn ich alles richtig mache, bin ich vorn« kehrt sich auf ungnädigste Weise um und lässt keine Linderung durch die Erklärung der Bedingungen zu. Es ist der eigene Anspruch, der den Maßstab setzt, der verhängnisvolle Glaube an die Hoheit über die eigene Leistung.
Sven Hannawald hat immer versucht, den perfekten Sprung zu springen. Als Kind hat er geweint, wenn ihm nicht der weiteste Satz gelungen ist. Heute zeigt er seinem Manager stolz ein Foto von einem Fußballspiel, bei dem er gerade drei Tore geschossen hat. Sein Verein spielt in der Kreisliga, die lokale Zeitung berichtete darüber. Fußball ist sein Hobby. Sein Beruf ist es jetzt, Autorennen zu fahren. Wenn er verliert, weint er nicht mehr. Dazu gewinnt er zu selten. Aber er hat wieder einen Inhalt, der ihm hilft, mit der Vergangenheit abzuschließen. Nach seinem letzten Sprung versuchte er als TV-Kommentator eine neue Rolle in seiner vertrauten Welt zu finden. Das hat nicht funktioniert. Weil er nicht funktionierte. Als Beobachter am Rande der eigenen Leidenschaft zu stehen, in Sichtweite der selbstgewählten Leerstelle, das hat er nicht ausgehalten.
Erst seit er im Motorsport eine neue Aufgabe fand, traut er sich wieder an die Schanze. Seit er eine Vorstellung davon hat, sein Auto auf eine ähnliche Weise zu beherrschen, wie es ihm mit seinem Sprungski von klein auf selbstverständlich war, empfindet er wieder Sinn und Lebensfreude. Vielleicht sogar eine ganz neue Form der Lebensfreude, eine, die ihn befreit vom Druck der eigenen Verantwortlichkeit. Und er hat jetzt verstanden, was seine Faszination ist: Das Adrenalin, das seinen Körper auf eine einzigartige Weise ausfüllt, ihn eins mit dem umkämpften Partner sein lässt, das spürt er auf der Rennstrecke auf eine Weise, wie er es bis dahin nur auf der Schanze zu spüren vermochte.
Sein Perfektionismus hat Sven Hannawald zum besten deutschen Skispringer aller Zeiten werden lassen. Der Preis war seine Gesundheit. Zu seiner Burnout-Erkrankung hat er sich öffentlich bekannt, weil er »keine Schwäche darin sieht, dazu zu stehen, dass ein glamouröses Leben auch seine Schattenseiten hat«. Aber er mag nicht darauf reduziert sein, in der Nachbetrachtung seiner Karriere zur Symbolfigur der Salonfähigkeit psychischer Erkrankungen gemacht zu werden.
Die Bereitschaft, für den Erfolg einen Preis zu zahlen, der über das natürliche Quantum dessen, was das Leben an jedem Tag an Handel verlangt, hinausgeht, ist vielleicht der kleinste gemeinsame Nenner der Erfolgreichen.
In einer Zeit, in der nur noch die Wenigsten in ein Amt hineingeboren werden, liegt selbst den aufsehenerregenden Karrieren meist kein klarer Plan zugrunde. Kaum einer meiner Gesprächspartner hat seinen unvermeidlichen Erfolg schon im Kindesalter verkündet. Sie wollten einfach ihre Traumrolle tanzen, eine Idee verwirklichen oder gleich die ganze Welt verändern und waren dafür bereit, geschundene Körper, ermüdende »Wahlkampf-Tingeltouren«, den Verlust der Privatheit, Bindungslosigkeit und auch das Scheitern in Kauf zu nehmen. Das Bewusstsein, Grenzen zu überschreiten, tritt dabei fraglos hinter den eigenen Anspruch zurück und bleibt oft lange, manchmal ganz und gar unbemerkt. Doch wird der Preis gezahlt für das Versprechen auf ein Ziel, eine Beförderung, eine Medaille, einen Wahlsieg? Oder auf die Erfüllung des Versprechens? In welchen Momenten findet die Belohnung statt?
Bei seinem Lauf zur Eckfahne, nachdem der Ball im Tor zappelte, habe er für vier oder fünf Sekunden uneingeschränktes Glück empfunden, schildert der ehemalige Fußball-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger ergriffen seine ganz persönliche Belohnung. Die Szene, die er als kleiner Junge nächtelang geträumt, auf der Straße im verschwitzten Nickipulli tausendfach vorgespielt hatte. Das entscheidende Tor im entscheidenden Spiel. Der Treffer, der den VfB Stuttgart 2007 am letzten Spieltag der Bundesligasaison zum Deutschen Meister machte. Eine tollkühne Bolzplatzphantasie und deren spektakuläre Verwirklichung.
Er schaut sich die Aufnahmen heute noch manchmal an. Die vom Tor, dem Jubel und den Momenten danach. Doch das Gefühl kommt nicht zurück. Das bedauert er. Aber er erinnert sich daran, dass er diesen Tag als Belohnung empfunden hat. Dass alles Erfüllung fand, in einem beherzten Schuss auf das Cottbusser Tor. Alles, was er vermeintlich geopfert hat, in seiner Jugend als angehender Fußballprofi. Partys mit Klassenkameraden, sommerlange Interrailreisen, Schulhofturteleien und exzellente Mathenoten. Vermisst hat er all das damals nicht. Er wollte einfach Fußball spielen, besser als andere und besser auch als er selbst.
Lange war der Perfektionismus sein Freund. Sein innerer Ansporn, sein strengster Trainer. Mit achtzehn Jahren ging er nach England, angezogen von der rauen Ehrlichkeit des Kick-and-Rush-Fußballs. Diese britischen Jahre beschreibt er als einen Rausch: die ersten Profieinsätze; die Premiere-League, das begehrenswerteste Anstellungsverhältnis für einen Berufsfußballspieler; Berufung zur Deutschen Jugendnationalmannschaft; der besondere Status, schon als Jungprofi aus dem Ausland eingeflogen zu werden; die ersten aufmerksamen Zeitungsberichte; die ständigen Besuche von bewundernden Freunden aus Deutschland.
Er stockt jetzt, nach jedem einzelnen Satz, so, als würde er sich beim Aufzählen nachträglich vor jeder Station und vor seinem eigenen Mut verbeugen wollen. Vor der ambitionierten Neugierde, die ihn in die Fremde hat ziehen lassen, heraus aus der beschaulichen Provinz und der behüteten Großfamilienidylle mit den sechs Geschwistern. Heute, da ihm alles so viel mehr Kraft und Opfer abverlangt, wirkt er beim Erzählen dieser lebensleichten Phase so leuchtend, als fabuliere der kleine Thomas von damals über seinen Traum von der ruhmreichen Profilaufbahn.
Thomas Hitzlsperger hat sich nicht ausgeruht auf seiner aufsehenerregenden Leistung im Teenageralter. Er hat sich nicht bremsen lassen durch die Bejubelungen seines Umfeldes, das ihn schon früh an der Spitze sah. Auch die Verlockungen der Popularität konnten ihn nicht ablenken. Er wollte besser werden, der Beste sein. »Ich habe immer wieder die Geschichten gehört, von David Beckham, der nach dem Training noch stundenlang Freistöße übt, obwohl er längst ein Superstar ist.« Also hat er auch Freistöße geschossen. Schüsse, die ihn zum nächsten Verein, einem Top-Club, bringen sollten, und in die Nationalmannschaft. Es gab immer noch eine Station weiter oben. Ein gewonnenes Spiel war gut, »aber zufrieden war ich erst, wenn ich ein Tor geschossen oder das Spiel maßgeblich beeinflusst hatte«. Der Druck, sagt er leise, sei immer aus ihm selbst heraus entstanden.
Sven Hannawald spricht auch über widrige Phasen und kalte Winter in gleichbleibender Lautstärke und ohne hörbare Nachdenklichkeit. Er ist überhaupt ein extrem entspannter Gesprächspartner. Keine Vorsicht, kein Argwohn hemmen ihn beim geteilten Blick auf seine außergewöhnliche Sportlerlaufbahn. Das Urteil der Öffentlichkeit hat er nie gefürchtet, dazu weiß er zu genau, dass die Menschen ihm wohlgesonnen sind. Selbst unter Journalisten gibt es viele »kleine Hannawald-Fans«. Er macht es ihnen auch leicht. Während unseres Gesprächs nimmt er kurz einen Anruf an. Der Termin für ein Fotoshooting am nächsten Tag soll um zwei Stunden, auf 7 Uhr frühmorgens, vorverlegt werden. Wegen des besseren Lichtes. Sven Hannawald hört kurz zu, lässt sich überzeugen und kündigt sein pünktliches Erscheinen so umgänglich an, als sei die...