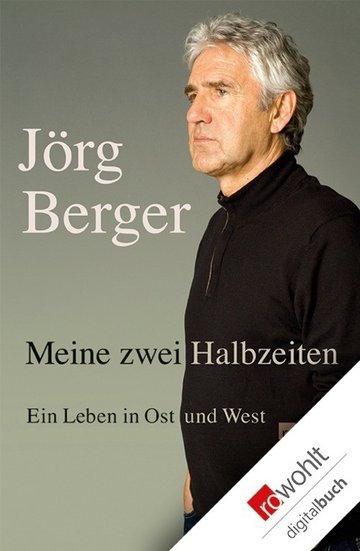2 Mit falschem Pass im Haschisch-Express
Erst als der Zug bereits einige Minuten in Bewegung war, setzte ich mich erschöpft auf den nächstbesten freien Platz. Doch schon überfiel mich der nächste Schrecken: Mir wurde in aller Deutlichkeit bewusst, dass ich meine Flucht überhaupt nicht organisiert hatte. Ich, der vierunddreißig Jahre im Arbeiter-und-Bauern-Staat lebte, in dem «Planerfüllung» an oberster Stelle stand, hatte anscheinend nicht viel gelernt. Aus einem Bauchgefühl heraus hatte ich die Fahrkarte nach Belgrad gekauft, instinktiv hatte ich Zahnschmerzen vorgetäuscht – mehr aber auch nicht.
Wie sollte ich eigentlich von Belgrad aus in die Bundesrepublik kommen? Ich hatte nicht die geringste Idee, dabei war ich von meinem Ziel noch weit entfernt. Sehr weit. Mit diesem Moment war ich zwar wie Lutz Eigendorf ein Republikflüchtiger, ein «Verräter». Im Gegensatz zu ihm konnte ich aber noch gefasst werden. Ich musste mir dringend etwas einfallen lassen.
Als sich ungefähr gegen acht, halb neun der Zug dem Belgrader Bahnhof näherte, überlegte ich angestrengt. Ich kannte ihn nicht. Vielleicht war er ein Kopfbahnhof wie der in Leipzig, wo man leicht jemandem in die Arme laufen konnte. Es war nicht abwegig, sich vorzustellen, dass man mich dort erwartete. Die Spieler und die Delegationsteilnehmer waren beim Frühstück, dabei musste ihnen längst meine Abwesenheit aufgefallen sein. Ein einziger Anruf in der Belgrader DDR-Botschaft genügte, um entsprechende Maßnahmen einzuleiten.
Zu meinem Vorteil waren die damaligen Züge so konstruiert, dass man sie während der Fahrt öffnen konnte. Als der Containerbahnhof von Belgrad sichtbar wurde – er war dem Bahnhof für Personenzüge vorgelagert, das hatte mir ein Mitreisender erzählt –, verlangsamte der Lokführer die Geschwindigkeit, der Zug stand fast. Diesen Moment nutzte ich aus, um vom Trittbrett herabzuspringen.
Über viele Gleise gelangte ich in eine Nebenstraße des Bahnhofs mit kleinen Läden und Cafés. In einem von ihnen trank ich eine Cola, nicht eine Club-Cola, wie es sie in der DDR gab, sondern eine Coca-Cola.
Als ich das Glas mit dem braunen Getränk in der Hand hielt, wurde mir klar: Ich musste zur westdeutschen Botschaft. Ernsthafte Alternativen fielen mir nicht ein, sosehr ich auch verschiedene Möglichkeiten durchspielte, etwa eine nächtliche Grenzüberquerung. Alles, was in diese Richtung ging, verwarf ich sofort. Es schien mir zu gefährlich – einen Helden wollte ich nicht spielen. Doch wo lag die Botschaft? Da ich keine Ahnung hatte, blieb mir nichts anderes übrig, als jemanden zu fragen. Zuerst schaute ich mir einige Westautos an, die vor einer Ampel hielten. Ich konnte mich aber nicht überwinden, einen der Fahrer anzusprechen. Zu schnell schaltete die Ampel auf Grün, dies war eindeutig nicht die richtige Situation, um nach dem Weg zu fragen. Dann betrat ich ein Bahnhofshotel. In der Lobby saß eine Gruppe von Männern beisammen, die Deutsch sprachen. Waren das westdeutsche Touristen oder Handelsreisende? Oder etwa DDR-Bürger? Auch damit musste ich rechnen. Wenn dem so war, konnten es nur Privilegierte meines Staates sein – und die würden keineswegs behilflich sein wollen.
Mich verließ der Mut, verzagt trat ich aus dem Hotel heraus und wanderte ziellos durch die Straßen. Schließlich sprach ich einen Jugoslawen an, fragte ihn, ob er vielleicht wüsste, wo die westdeutsche Botschaft läge. Er schüttelte nur den Kopf, konnte es mir nicht sagen, vielleicht hatte er mich auch erst gar nicht verstanden.
Swissair! Über einem Schaufenster hing ein Schild mit dieser Aufschrift. Es handelte sich um eine Agentur der Schweizer Fluggesellschaft. Ich öffnete die Tür. Hinter einem Schalter stand eine Frau, die ich ansprach: «Können Sie mir sagen, wie ich das Büro der Lufthansa finde?» Die deutsche Fluglinie musste die Adresse der Botschaft kennen und die Fluggesellschaften untereinander die jeweiligen Niederlassungen. Richtig gedacht! Auf Schweizerdeutsch erklärte mir die Dame, wie ich zum Lufthansa-Center kommen würde, dazu verließ sie sogar ihren Schalterbereich und trat mit mir vor die Tür.
Ganz einfach war es nicht, das Lufthansa-Büro ausfindig zu machen, aber schließlich war ich da.
«Gibt es hier jemanden, der Deutsch spricht und aus der Bundesrepublik ist?», fragte ich einen Mann, der meiner Einschätzung nach ein Jugoslawe war.
«Worum geht es denn?» Der Angesprochene beherrschte ein sehr gutes Deutsch, doch, wie ich vermutet hatte, mit einem Akzent.
«Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich möchte gern mit einem Westdeutschen reden.»
Der Jugoslawe ging in den hinteren Teil der Räumlichkeiten, ohne dabei eine Miene zu verziehen. Nach einer Weile kam er in Begleitung eines jüngeren Mannes zurück.
«Kann ich Sie bitte unter vier Augen sprechen?», fragte ich diesen.
Wortlos wies er mit der Hand in Richtung Hinterzimmer. Dort erzählte ich ihm in einer Kurzversion von meiner Flucht. Am Ende meines Berichts sagte er: «Ich habe von dem Länderspiel gehört. Können Sie sich ausweisen?»
Es gab damals Gerüchte über geplante Anschläge der RAF auf Botschaften, deshalb war man besonders vorsichtig. Immerhin konnte ich ein Terrorist sein. Von diesen Zusammenhängen und den verstärkten Sicherheitsmaßnahmen wusste ich jedoch noch nichts.
Der Lufthansa-Mitarbeiter schaute sich meinen Ausweis an. «Sie sind jetzt hier in Belgrad, Herr Berger. Aber wie soll es weitergehen?»
«Ich möchte zur Botschaft der Bundesrepublik Deutschland. Vielleicht kann man mir dort helfen. Ich könnte politisches Asyl beantragen.»
«Das ist eine gute Idee. Aber Sie gehen dort nicht allein hin, ich werde Sie begleiten.»
Ich konnte kaum glauben, dass dieser Mann mir zur Seite stehen wollte. Hatte er schon öfter mit Flüchtlingen zu tun gehabt? Ich wagte nicht, ihn danach zu fragen. Bevor wir aufbrachen, schenkte er mir noch einen Kaffee ein und bot mir etwas von seinen mitgebrachten Broten an.
Die Strecke sei nicht weit, man könne zu Fuß dorthin, gab er mir zu verstehen, als wir uns auf den Weg gemacht hatten. Nach und nach wurde es leerer auf den Straßen, die Häuser lagen weit auseinander, wirkten vornehm.
«Da vorn ist die deutsche Botschaft», sagte mein freundlicher Begleiter auf einmal und zeigte auf ein großes, helles Gebäude. Es war leicht nach hinten versetzt und mutete für damalige Zeiten modern an. «Gehen Sie nicht so nah an der Straße. Man könnte sie von DDR-Seite aus schon erwarten.»
Angstschweiß brach aus mir heraus. An was alles hätte ich denken müssen, an was alles hatte ich nicht gedacht! Eigentlich war es eine naive Vorstellung, einfach die westdeutsche Botschaft aufsuchen zu wollen. Unabhängig von der SED-Propaganda war Jugoslawien doch ein sozialistisches Land mit engen Kontakten zur Deutschen Demokratischen Republik. Vielleicht würde ich mit meinem Pass erst gar keinen Zutritt zur BRD-Botschaft erhalten? Dann hätte ich ein gewaltiges Problem.
War es überhaupt schon mal vorgekommen, dass ein DDR-Bürger in Belgrad um Asyl gebeten hatte? Mir war nichts dergleichen bekannt. Aber man hätte dies auch nicht groß in den Zeitungen thematisiert. Keiner konnte ein Interesse daran haben, dass solche Fluchtmöglichkeiten publik wurden, weder die BRD noch die DDR.
Kurz darauf standen wir vor der Kneza Miloša 76. Wir gingen ein paar Treppenstufen hinauf bis zu einer Glaswand, hinter der ein Angestellter der Botschaft saß. Nach einer Aufforderung schoben mein Begleiter und ich unsere Pässe durch einen dafür vorgesehenen Schlitz. Als sich der Botschaftsmitarbeiter meinen Ausweis ansah, sagte ich: «Ich bin Bürger der DDR.» Der Mann schaute mich ein wenig merkwürdig an, dann antwortete er: «Sie sind Deutscher.»
Sie sind Deutscher! Als ich diese Worte hörte, liefen Schauer über meinen Rücken. Nie hatte ich Deutscher sein dürfen, stets hieß es, ich sei Bürger der DDR.
Konnte der Angestellte ahnen, was dieser Satz bei mir auslöste? Für mich bedeutete es: Ich war angekommen! Ich war noch nicht im Westen, aber ich war angekommen!
Nachdem der Mann aus dem Lufthansa-Büro erklärt hatte, dass ich mich als Trainer von meiner Fußballmannschaft abgesetzt hätte, verabschiedete er sich von mir. Nun konnte ich mich in Sicherheit wissen. Später wurden DDR-Bürger, die in westdeutsche Botschaften flüchteten, tatsächlich wieder zurück in ihre Heimat geschickt, wo sie Schikanen ausgesetzt waren. Das hörte meist erst dann auf, wenn sie vom Westen freigekauft wurden.
Man führte mich in den ersten Stock des Gebäudes, ein anderer Botschaftsangehöriger setzte die Unterredung fort. Es fiel mir nicht leicht, meine Geschichte zu erzählen. Immerhin war ich nicht gekommen, weil mir Reisegepäck und Ausweisunterlagen gestohlen worden wären. Nach und nach wurde mir klar, dass ich aus Sicht meines Gesprächspartners nicht auf «klassische» Weise geflüchtet war: Ich hatte kein bestimmtes Vorgehen verfolgt, keine Fluchthelfer und keine konkrete Zieladresse. Das sollte die Stasi freilich völlig anders sehen.
«Kennen Sie trotzdem jemanden in der Bundesrepublik, der Ihre Identität bestätigen kann?»
Ich schüttelte den Kopf. Man wollte verständlicherweise sichergehen, das ich auch der war, für den ich mich ausgab. Nur dann konnte man mir weiterhelfen.
«Denken Sie bitte noch einmal nach.»
Schließlich hatte ich einen Einfall. «Walter Eschweiler könnte mich...