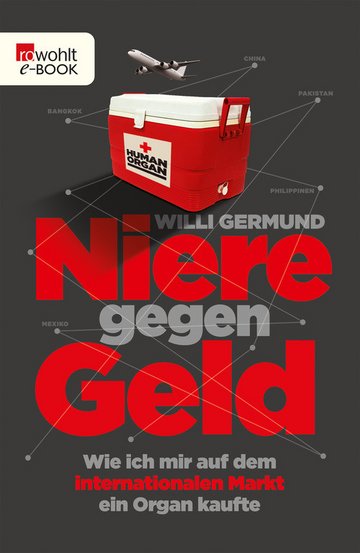«Du bekommst eine richtig gute Niere von mir.»
Ich sterbe seit rund sechs Monaten. Es geht zwar im Schneckentempo abwärts, aber deutlich spürbar. Langsam neigt sich auch meine Geduld dem Ende zu, denn der schleichende Tod ist abwendbar. Vor einem halben Jahr haben meine Nieren nach Jahren der stetigen Verschlechterung vollständig ihre Funktion eingebüßt. Seitdem muss ich mich dreimal pro Woche einer Dialyse unterziehen. Die Maschine wäscht das Blut von Menschen, deren Nieren nicht mehr funktionieren. Sie hält mich am Leben und zerstört gleichzeitig langsam, aber sicher meinen Körper.
Als ich an diesem späten Montagvormittag mitten im Hochsommer in einer nordmexikanischen Stadt aus dem Dialysezentrum in die grelle Wüstensonne hinaustrete und mir eilig einen breitkrempigen Hut auf den Kopf setze, bin ich zum ersten Mal seit Monaten nicht ungeduldig. Ich habe während der vergangenen vier Stunden bei der Behandlung zwar wieder ein paar Nervenfunktionen eingebüßt, aber zum ersten Mal in rund sechs Monaten kann die übliche Erschöpfung nach der Blutwäsche meiner guten Laune nichts anhaben. Stattdessen tobt in meinem Innern ein Chaos aus Vorfreude, unbestimmter Nervosität, Furcht und banger Erwartung.
Vor allem schwelge ich in Emotionen, die ich seit meinem Nierenversagen nicht mehr kenne: Ich fühle mich wie ein Glückspilz. Dabei habe ich mich gerade erst voller Verlegenheit aus dem Behandlungszentrum mit dem freundlichen Personal und den netten mexikanischen Patienten gestohlen. «Verabschiedet euch von Willi», verkündet plötzlich und ohne mich zu fragen, die Leiterin des Zentrums, als sie die Verbindungskanülen zwischen mir und der Dialysemaschine trennt. «Wünscht ihm viel Glück, denn heute ist er wahrscheinlich zum letzten Mal bei uns zu Besuch. Er soll morgen eine neue Niere erhalten.» Es ist mir peinlich und unangenehm, dass meine Leidensgenossen auf diese Weise von meinem Plan erfahren. Schließlich bin ich der Glückliche, der dem schleichenden Tod entkommt, zu dem sie dank der Dialysebehandlung und mangels Spenderniere zumindest vorerst verurteilt bleiben – falls bei meiner geplanten Operation alles gutgeht.
Außer mir ist keine Menschenseele auf den Straßen dieses Ortes voller Spielkasinos, gigantischer Supermärkte mit riesigen Parkplätzen und einer Unzahl von medizinischen Kliniken zu sehen. Der Sommer in der nordmexikanischen Wüste eignet sich nicht für Spaziergänge kurz vor der Mittagszeit. Der Asphalt scheint zu kochen, jeder Schweißtropfen verdunstet sofort auf der Haut.
Ein paar hundert Meter entfernt erhebt sich das meterhohe, hässliche und verrostete Monstrum aus Stahl, mit dem die USA sich von Lateinamerika abschirmen. Die düstere Barriere trennt den amerikanischen Kontinent in den wohlhabenden Norden und die ärmlichere Region des Südens. Dank der zahllosen, oft namenlosen Kreuze auf der mexikanischen Seite wirkt die Stahlwand wie der Todesstreifen, den Deutschland im Jahr 1989 endlich abschaffen konnte.
Trotz der gemeinen Abweisung durch den Norden haben Lateinamerikaner jahrelang fast alles unternommen, um diese stählerne Hürde zu überwinden. Für viele US-Bürger, die sich die hohen Kosten einer medizinischen Behandlung nicht leisten können oder wollen, hat diese Grenze einen großen Vorzug: Mexikos Ärzte kurieren und operieren für weitaus weniger Geld als ihre Kollegen im Norden. Deshalb strömen US-Amerikaner zu Tausenden über die Grenze in den Norden Mexikos, um sich dort trotz gewalttätigem Drogenkrieg für vergleichsweise niedrige Honorare behandeln zu lassen. Die Ärzte südlich des Rio Grande schneiden auch im Preisvergleich mit Europa besser ab, wie die verknüllte, handgeschriebene Rechnung in meiner Hosentasche beweist. Ich habe nur einen Bruchteil der Summe bezahlt, die ich in Deutschland für eine Dialyse auf den Tisch legen müsste.
Vor vier Stunden war ich mit meiner Flasche Wasser, ein paar belegten Broten und einem Buch im Behandlungszentrum angekommen, in dem ich seit meiner Ankunft in Mexiko gezwungenermaßen alle zwei Tage zu Gast war – heute zum letzten Mal, wenn alles nach Plan geht. Vor ein paar Wochen hätte ich dank der Dialyse nur eine paar Tage länger überlebt. Heute wurde mein Körper entgiftet, damit auch noch 24 Stunden später nicht zu viel Schmutz in meinen Adern herumschwimmt – denn morgen früh, so ließ mir mein mexikanischer Chirurg aus einem nahegelegenen Privatkrankenhaus ausrichten, soll es so weit sein.
Ich werde eine fremde Niere erhalten.
Ich, der vergleichsweise betuchte Europäer, habe einem jungen Afrikaner Geld für eine seiner gesunden Nieren bezahlt. Ich bin die wandelnde Inkarnation des kranken Patienten, der sich auf dem florierenden, aber weltweit geächteten, gesetzlich regulierten und von vielen als verwerflich betrachteten Organmarkt eine Zukunft gekauft hat. Ab Dienstagnachmittag werde ich, wenn die Operation wie geplant verläuft, wieder die Chance haben, ein «fast normales Leben zu führen», wie mir einer der vielen, während der vergangenen Monate von mir konsultierten Spezialisten versprochen hatte.
Von einem solchen normalen Leben ist kaum etwas übrig geblieben, seit vor etwas mehr als sechs Monaten meine beiden Nieren wegen eines genetischen Defekts endgültig ihren Dienst quittiert hatten. Seitdem diktiert die Dialysemaschine meinen Alltag.
Da meine Nieren keine verbrauchten Nährstoffe mehr ausscheiden, sammeln sich Flüssigkeit und Schadstoffe im Körper. Ich vergifte mich quasi selbst. Alle zwei, spätestens alle drei Tage muss mein Blut deshalb mit Hilfe der sogenannten Dialyse sprichwörtlich ausgewaschen werden. Ob zu Hause oder unterwegs: Seit sechs Monaten bildet die Blutwäsche den neuen Mittelpunkt meines Lebens. Ich ordne meine Verabredungen dem Behandlungsstundenplan unter. Bestellungen in Restaurants müssen mit meinem Diätplan abgestimmt werden, den mir Ärzte mit einem Sammelsurium von Medikamenten in die Hände gedrückt haben.
Oberhalb meines rechten Schlüsselbeins ragen zwei schmale Plastikschläuche aus meinem Hals, die ein bis zwei Zentimeter über meiner Brustwarze enden. Zehn Zentimeter der biegsamen Kanülen stecken jeweils in einer Vene und einer Arterie im Körper. Sie reichen fast bis ins Herz. Die äußeren Enden der schmalen Schläuche sind sorgsam in Mull und steriles Plastik verpackt auf meinem Brustkorb festgeklebt, wenn ich nicht an der für mich überlebenswichtigen Maschine hänge.
Die Ärzte haben sich mit diesen provisorischen «Tankstutzen» zufriedengegeben, weil ich darauf bestand. Schon vor dem ersten Dialysetermin verkündete ich ihnen, dass ich bald per Transplantation eine fremde Niere erhalten würde. Normalerweise wird Patienten ein «Shunt», ein spezieller Gefäßzugang, am rechten oder linken Unterarm gelegt, ein permanenter Anschluss, an den bei jeder Blutwäsche die Maschine angedockt werden kann. Die provisorische Übergangslösung, die aus meiner Halsbeuge baumelt, birgt das Risiko vieler Komplikationen.
Shunt und hervorstehende Kanülen haben ohnehin viele Tücken. Im Laufe der Zeit können sie verstopfen, die direkt mit Adern verbunden Öffnungen können Infektionen direkt ins Blut befördern. Deshalb ist strenge Hygiene rund um die Kanülen das höchste Gebot. Es gilt eine eiserne Regel, die irgendwann fast jeden Dialysepatienten nervt: Der Waschlappen ersetzt das Vollbad. Man darf sich weder baden noch duschen, damit keine Feuchtigkeit an die Öffnungen zum Körperinneren gerät. Krankenschwestern reinigen die unmittelbare Umgebung der «Tankstutzen» mit Alkohol.
Selbst wenn es keine anderen Einschränkungen im Leben mit der Dialyse gäbe: Das Badeverbot genügt, um mich schier in den Wahnsinn zu treiben. Die Haut juckt unter dem Mullverband, und der Waschlappen spendet keine Labsal. Er provoziert Wutanfälle. Die Sehnsucht nach einem Vollbad gerät schnell zur Besessenheit.
Nur der ewige Durst und die unersättliche Gier nach kalten Getränken übertrifft den Ingrimm über das Badeverbot. «Maximal zwei Liter Flüssigkeit pro Tag», lautet die Anweisung der Mediziner. Das klingt erst mal nicht nach mühevoller Einschränkung. Ich habe zwei volle Literflaschen mit Mineralwasser vor Augen. Es stellt sich schnell heraus, dass diese Rechnung nicht funktioniert. Jeder Tropfen zählt. Suppen landen deshalb als Erstes auf der Liste verbotener Speisen. Gemüse und gekochte Kartoffeln füllen das Zwei-Liter-Maximum schneller, als Nierenpatienten lieb sein kann. Da helfen nur gelegentliche Eiswürfel und viele saure, dünngeschnittene Zitronenscheiben, um den allgegenwärtigen Durst zu beherrschen.
Der Grund für das strikte Regiment: Nierenversagen bedeutet, dass fast kein Urin mehr ausgeschieden wird. Jeder Tropfen muss deshalb auf andere Weise aus dem Körper gesaugt werden. Das ist einer der Prozesse, die während der drei bis vier Stunden langen Blutwäsche ablaufen. Der Entzug von zwei bis vier Kilogramm Körperflüssigkeit stellt wiederum eine schwere Belastung des Kreislaufs dar. Andererseits hängt die Menge von der Flüssigkeitsaufnahme während der Tage zuvor ab. Wer zu viel hat, geht mit Wasser im Leib wieder nach Hause. Flüssigkeit samt Schadstoffe im Körper müssen bei der nächsten Dialyse entsorgt werden, wenn der gesamte Blutkreislauf wieder durch die Filtermembrane der Dialysemaschine geleitet wird. Außerdem sammelt sich die Flüssigkeit in Füßen und Beinen und beschädigt dort die Nerven.
Die Blutwäsche verhindert, dass der Körper vergiftet wird. Sie verlängert Leben. Aber die Dialyse ist eine Maschine und keine Niere. Sie zerstört gleichzeitig in minimalen, aber kontinuierlichen Schritten den Körper. Als Erstes...