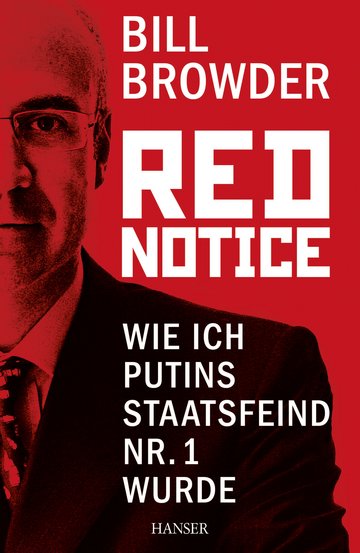Kapitel 1
Persona non grata
13. November 2005
Ich bin ein Zahlenmensch, deshalb nenne ich die wichtigsten Zahlen gleich am Anfang: 260, 1 und 4,5 Milliarden.
Die Zahlen bedeuten Folgendes: Jedes zweite Wochenende reiste ich von Moskau, der Stadt, in der ich lebte und arbeitete, in meine Heimatstadt London. In den vergangenen zehn Jahren hatte ich diese Reise 260-mal gemacht. Der Hauptgrund war mein Sohn David, damals acht Jahre alt, die Nummer eins in meinem Leben, der bei meiner Exfrau in Hampstead lebte. Bei der Scheidung hatte ich mich verpflichtet, ihn jedes zweite Wochenende zu besuchen, komme, was wolle. Ich hatte mein Versprechen nie gebrochen.
Für meine regelmäßige Rückkehr nach Moskau gab es 4,5 Milliarden Gründe. Das war der Gesamtwert des Vermögens in Dollar, das meine Investmentfirma Hermitage Capital verwaltete. Ich war ihr Gründer und CEO und hatte in den vergangenen zehn Jahren das Vermögen vieler Anleger gewaltig vermehrt. Im Jahr 2000 war Hermitage Capital zum Emerging-Markets-Fonds mit der besten Performance gekürt worden. Wir hatten für Anleger, die seit unserer Gründung 1996 mit von der Partie waren, Renditen von 1500 Prozent erzielt. Der Erfolg meiner Firma hatte selbst meine kühnsten Erwartungen übertroffen. Russland bot nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion einige der spektakulärsten Investitionsmöglichkeiten in der Geschichte der Finanzmärkte, allerdings war die Arbeit dort ebenso abenteuerlich (und gelegentlich auch gefährlich) wie lukrativ. Langweilig war sie auf jeden Fall nie.
Ich war schon so oft von London nach Moskau geflogen, dass ich den Ablauf in- und auswendig kannte: Wie lange man für die Sicherheitskontrollen in Heathrow benötigte; wie lange das Boarding der Aeroflot-Maschine dauerte; wie lange es brauchte, bis das Flugzeug in der Luft war und Kurs nach Osten in Richtung eines Landes nahm, wo es bereits Nacht war und wo Mitte November ein weiterer kalter Winter mit großen Schritten nahte. Die Flugzeit betrug 270 Minuten. Das genügte, um durch die Financial Times, den Sunday Telegraph, das Forbes Magazine und das Wall Street Journal zu blättern und wichtige E-Mails und Dokumente zu lesen.
Als das Flugzeug an Höhe gewann, öffnete ich meine Aktentasche und nahm meine Tageslektüre heraus. Neben den Akten, Zeitungen und Zeitschriften befand sich auch eine kleine Ledermappe in der Tasche. Darin waren 7500 Dollar in 100-Dollar-Noten. Sie verschafften mir bessere Chancen bei einer Flucht aus Moskau, beim sprichwörtlichen letzten Flug – wie damals denjenigen, die gerade noch rechtzeitig aus Phnom Penh oder Saigon herausgekommen waren, bevor das jeweilige Land im Chaos versank.
Aber ich floh nicht aus Moskau, ich kam zurück. Ich kehrte zurück an meine Arbeit. Und deshalb wollte ich mich über die neuesten Nachrichten vom Wochenende informieren.
Gegen Ende des Flugs stieß ich im Forbes Magazine auf einen Artikel, der mir zu denken gab. Es ging um einen Geschäftsmann, der wie ich seinen MBA in Stanford gemacht hatte. Er hieß Jude Shao, ein chinesischstämmiger Amerikaner, der ein paar Jahre nach mir studiert hatte. Ich kannte ihn nicht, aber er machte wie ich erfolgreich Geschäfte in einem fremden Land, in seinem Fall in China.
Er hatte sich mit einigen korrupten chinesischen Funktionären angelegt und im April 1998 wurde Shao verhaftet, nachdem er sich geweigert hatte, einem Steuereintreiber in Schanghai 60 000 Dollar Bestechungsgeld zu zahlen. Shao wurde schließlich aufgrund erfundener Anklagen zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Einige ehemalige Studenten von Stanford hatten eine Kampagne zu seiner Befreiung organisiert, aber nichts erreicht. Als ich von Shaos Schicksal erfuhr, versauerte er gerade in einem elenden chinesischen Gefängnis.
Mir lief es eiskalt den Rücken herunter. China war zehnmal so sicher wie Russland, wenn es um Geschäfte ging. Beim Landeanflug auf den Flughafen Moskau-Scheremetjewo fragte ich mich, ob ich vielleicht doch ein bisschen leichtsinnig war. Jahrelang war ich beim Investieren dem Ansatz gefolgt, die Interessen der Aktionäre in den Vordergrund zu rücken. In Russland hieß das, die Korruption der Oligarchen infrage zu stellen, der etwa 20 Männer, die Berichten zufolge nach dem Sturz des Kommunismus 39 Prozent des Landes an sich gebracht hatten und über Nacht Milliardäre geworden waren. Den Oligarchen gehörte die Mehrheit der russischen börsennotierten Unternehmen, die sie oft regelrecht ausplünderten. Bei meinem Kampf gegen die Oligarchen hatte ich mich meistens durchgesetzt. Doch diese Strategie hatte zwar meinem Fonds großen Erfolg beschert, mir aber auch viele Feinde eingebracht.
Nachdem ich den Artikel über Shao gelesen hatte, dachte ich: Vielleicht sollte ich damit aufhören. Ich habe so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Ich hatte nicht nur David, sondern auch eine neue Frau in London. Elena war Russin, wunderschön, unglaublich intelligent und derzeit schwanger mit unserem ersten Kind. Vielleicht sollte ich ein bisschen kürzertreten.
Aber dann setzten die Räder auf der Landebahn auf, und ich legte die Zeitschriften weg, schaltete meinen BlackBerry ein und schloss die Aktentasche. Ich sah nach meinen E-Mails und konzentrierte mich wieder darauf, was ich während des Fluges verpasst hatte. Jude Shao und die Oligarchen waren vergessen. Ich musste durch den Zoll, danach zu meinem Wagen und dann in meine Wohnung.
Scheremetjewo ist ein seltsamer Flughafen. Der Terminal, wo ich mich am besten auskannte, Scheremetjewo 2, war für die Olympischen Sommerspiele 1980 errichtet worden. Damals hatte das Gebäude sicher sehr beeindruckend gewirkt, aber im Jahr 2005 war alles ziemlich heruntergekommen. Es roch nach Schweiß und billigem Tabak. Die Decke war mit reihenförmig angeordneten Metallzylindern dekoriert, die aussahen wie rostige Konservendosen. An der Passkontrolle gab es keine geordnete Warteschlange, sondern man musste sich ins Gedränge stürzen und aufpassen, dass sich niemand an einem vorbeidrängelte. Und wer eine Tasche dabeihatte, war ohnehin verloren. Dann musste man, auch wenn der Pass längst gestempelt war, mindestens noch eine Stunde auf das Gepäck warten. Nach einem über vierstündigen Flug war die Einreise nach Russland kein Spaß, vor allem nicht, wenn sich die Prozedur wie in meinem Fall jedes zweite Wochenende wiederholte.
Seit 1996 pendelte ich nach Moskau, aber erst im Jahr 2000 hatte mir ein Freund vom sogenannten VIP-Service erzählt. Gegen eine kleine Gebühr sparte man etwa eine Stunde, manchmal auch zwei. Das war zwar keineswegs luxuriös, aber jeden Penny wert.
Ich ging vom Flugzeug direkt zur VIP-Lounge. Die Wände und die Decke waren in einem fahlen Erbsengrün gestrichen. Der Linoleumboden war bräunlich. Die Sitzgelegenheiten in der Lounge waren mit einem braunroten Leder aufgepolstert worden und einigermaßen bequem. Beim Warten wurde einem dünner Kaffee oder Tee serviert, der zu lange gezogen hatte. Ich entschied mich für einen Tee mit einer Scheibe Zitrone und reichte dem Grenzbeamten meinen Pass. Dann vertiefte ich mich in die E-Mails auf meinem BlackBerry.
Ich merkte kaum, dass mein Fahrer Alexej, der eine Genehmigung für den Lounge-Bereich hatte, kam und mit dem Grenzbeamten plauderte. Alexej war 41 Jahre alt wie ich, aber im Gegensatz zu mir war er 1,95 Meter groß und wog 110 Kilo, hatte blonde Haare und markante Gesichtszüge. Er war früher bei der Moskauer Verkehrspolizei gewesen und sprach kein Wort Englisch. Er war immer pünktlich – bei kleineren Staus konnte er seine ehemaligen Kollegen überreden, ihn durchzulassen.
Ich beachtete das Gespräch nicht weiter, sondern beantwortete stattdessen meine E-Mails und trank den lauwarmen Tee. Nach einer Weile verkündete eine Lautsprecherdurchsage, dass das Gepäck von meinem Flug am Gepäckband abgeholt werden könne.
Da schaute ich auf und dachte: Bin ich schon seit einer Stunde hier?
Ich sah auf die Uhr. Tatsächlich, ich war seit einer Stunde hier. Das Flugzeug war um 19.30 Uhr gelandet, jetzt war es 20.32 Uhr. Meine Mitpassagiere in der VIP-Lounge waren schon lange weg. Ich sah Alexej an, er schaute zurück und gab mir zu verstehen: Ich kümmere mich darum.
Während er mit dem Beamten redete, rief ich Elena an. In London war es erst 17.32 Uhr, um die Zeit war sie daheim. Während unseres Gesprächs hielt ich den Blick auf Alexej und den Grenzbeamten gerichtet. Aus dem Gespräch wurde rasch eine hitzige Diskussion. Alexej trommelte ungeduldig auf den Schalter, während ihn der Grenzbeamte nur mit starrem Blick ansah. »Irgendetwas stimmt da nicht«, sagte ich zu Elena. Ich stand auf und ging zum Schalter, eher irritiert als beunruhigt, und fragte, was los sei.
Allmählich dämmerte mir, dass da etwas gewaltig schieflief. Ich schaltete Elena auf Lautsprecher, damit sie für mich übersetzen konnte. Sprachen sind nicht mein Ding – selbst nach zehn Jahren konnte ich mich auf Russisch gerade einmal mit dem Taxifahrer verständigen.
Das Gespräch ging hin und her. Ich stand daneben wie ein Zuschauer bei einem Tennismatch und drehte den Kopf hin und her. Elena sagte irgendwann: »Ich glaube, es hat etwas mit deinem Visum zu tun, aber der Beamte rückt nicht damit heraus.« In dem Moment tauchten zwei uniformierte Beamte in der Lounge auf. Der eine zeigte auf mein Telefon, der andere auf meine Taschen.
Ich sagte zu Elena: »Da sind zwei Beamte gekommen, ich soll auflegen und mitkommen. Ich rufe wieder an, sobald ich kann.«
Ich...