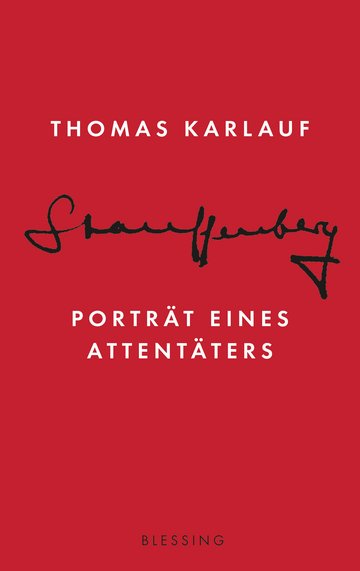Prolog
Totenwache
Am 2. Dezember 1933 reichte Claus Graf Stauffenberg, Oberleutnant im Reiterregiment 17 in Bamberg, bei seinem Dienstvorgesetzten, dem Chef der 5. Eskadron Rittmeister Walzer, dreitägigen Sonderurlaub ein. Am Morgen hatte ihn sein Bruder Berthold angerufen: Der Zustand des Meisters habe sich dramatisch verschlechtert, Claus müsse sich beeilen, wenn er ihn noch lebend sehen wolle. Der Meister – das war der Dichter Stefan George, dem die Brüder Stauffenberg in grenzenloser Bewunderung anhingen, seit sie ihm 1923 vorgestellt worden waren. Der 65-Jährige, in dem sie den größten lebenden Deutschen und den Künder eines neuen Zeitalters verehrten, lag in seinem Refugium oberhalb des Lago Maggiore im Sterben.
Claus nahm den Nachtzug nach München (Bamberg ab 3.12 Uhr), stieg dort am Morgen um nach Zürich, wo er Berthold traf, der aus Den Haag kam; gemeinsam erreichten sie am Sonntagabend gegen neun Uhr Locarno. Frank Mehnert, der Georges Leben im Tessin organisierte, hatte die beiden im »Buenos Aires« an der Uferpromenade auf halbem Weg zwischen Locarno und Minusio einquartiert. Vier Jahre jünger als Berthold von Stauffenberg und durch diesen als Gymnasiast in den Kreis um den Dichter eingeführt, war Mehnert dem Meister als ständiger Begleiter und Sekretär in den letzten Jahren unentbehrlich geworden.
George lag seit Anfang der Woche in der von frommen Schwestern geleiteten Klinik Sant’ Agnese, nur ein paar Gehminuten entfernt von seinem letzten Domizil. Claus von Stauffenberg betrat das Sterbezimmer gegen 22.30 Uhr. Dort saßen außer Berthold und Mehnert der von George bestimmte Haupterbe Robert Boehringer, den Stauffenberg hier, im Dunkel des Sterbezimmers, zum ersten Mal sah, der Berliner Leibarzt Walter Kempner sowie Bertholds Zwillingsbruder Alexander und der junge Karl Josef Partsch, genannt Cajo. Kurz darauf kamen drei Freunde hinzu, denen sich die Stauffenbergs besonders verbunden fühlten – Albrecht von Blumenthal, genannt Albo, Walter Anton, genannt der Löwe, und Ludwig Thormaehlen, der Bildhauer. Alle hätten auf Schemeln entlang der Wand gegenüber dem Fenster gesessen, wird Alexander von Stauffenberg zehn Jahre später dichten, und dann habe der Meister jedem Einzelnen von ihnen tief in die Augen geblickt, »als gälte es auf ewig sie zu bannen«.1 Aber der Meister erkannte niemanden. Als sein Atem um 1.15 Uhr stillstand, waren zehn Freunde im Raum versammelt. Mehnert drückte dem Toten die Augen zu.
Keiner sprach ein Wort. Gegen zwei Uhr gingen alle außer Kempner über die Brücke hinüber ins Molino, das ehemalige Mühlenhaus, in dem George auf der Flucht vor der feuchten Kälte des Nordens die letzten beiden Winter verbracht hatte. In dem Atelierraum, in dem sie immer empfangen worden waren – »drin unverkennbar sein vertrauter duft«2 –, hing jeder eigenen Erinnerungen nach. Dann fragte einer, was der Meister zuletzt eigentlich gelesen habe. Mehnert konnte berichten, dass er ihm am vorletzten Samstag nach dem Tee aus Jean Paul und abends, als der Meister bereits zu Bett gegangen war, ein Stündchen aus Tausendundeiner Nacht vorgelesen habe. Bis zur 48. Nacht seien sie gekommen, von dieser habe man noch eineinhalb Seiten geschafft. »Siehe, da kam ihm ein wunderbar schöner Reigen entgegen: mehr als zwanzig Mädchen, Mondsicheln gleich. Und als er sie ansah, war er vor Freuden fast von Sinnen, und er vergaß sein Heer.« An dieser Stelle habe der Meister unterbrochen, für heute sei es genug. Er zündete sich noch eine Zigarette an und ließ seine Gedanken zu den Mondsicheln schweifen. Es war immer das Gleiche: Über den Weibern vernachlässigen sie den Krieg.3
Am Sonntag sei es ihm dann bereits sehr schlecht gegangen. Am Tag darauf habe er nach dem Essen nur noch kurz in einer der spanischen Illustrierten geblättert, die ihm seine Hilfe, Frau Schlayer, gelegentlich mitbrachte, und sich am Nachmittag in Perthes’ grünen Taschenatlas vertieft. Das tat er in den letzten Jahren gern: auf Landkarten die Fahrten nachzeichnen, durch die das Aussehen unserer Erde verändert worden war, den Zug Alexanders zum Indus oder Humboldts Reise den Orinoko hinauf – Eroberungen, die sich schon der Phantasie des Knaben in all ihren Herrlichkeiten erschlossen hatten. An einem der letzten Abende hätten sie über die Abdankung Karls V. gesprochen, der sich von einem auf den anderen Tag in ein Landhaus in Kastilien zurückzog. Das sei für ihn wahre Herrschaft, sagte der Meister, seine Zelte abzubrechen, sobald die Zeit gekommen sei, und niemanden Rechenschaft ablegen zu müssen. Er könne das gut nachvollziehen, er habe das auch immer so gehalten.
Die Schwestern von Sant’ Agnese brauchten etwa zwei Stunden, die Leiche zu waschen und die sonstigen Vorkehrungen zu treffen. Zur vereinbarten Zeit gingen Berthold und Mehnert zurück in die Klinik und übernahmen die Wache. Robert Boehringer nutzte die frühen Morgenstunden für einen kurzen Schlaf und kam gegen acht Uhr nach. Um neun Uhr begannen zwei Bildhauer aus dem Tessin mit dem Abnehmen der Totenmaske; Thormaehlen achtete darauf, dass der Gips auch die großen, weit hörenden Ohren des Meisters einschloss, die Hände wurden ebenfalls abgegossen. Die Arbeiten zogen sich mehrere Stunden hin, Berthold und Boehringer führten abwechselnd die Aufsicht.
Als Claus von Stauffenberg am Mittag in der Klinik eintraf, fragte sein Bruder ihn, ob er die Totenwache organisieren könne. Das war keine leichte Aufgabe angesichts der zahlreichen Rivalitäten, die den Freundeskreis seit eh und je belasteten und nach den politischen Umwälzungen der jüngsten Zeit dramatische Formen angenommen hatten. Jeder musste bei der Einteilung berücksichtigt werden, keiner durfte sich zurückgesetzt fühlen. Stauffenberg beschaffte sich Stift und Papier und erstellte eine erste Liste mit den Namen derer, die bereits in Minusio eingetroffen waren und die noch erwartet wurden.
Eine zentrale Frage lautete, ob Frauen an der Wache beteiligt werden durften. Es ging vor allem um Clotilde Schlayer, die Freundin des Arztes, die sich in den letzten Jahren große Verdienste um den Meister erworben und nicht nur das Winterquartier in Minusio, sondern auch andere Unterkünfte besorgt und alles stets zu seiner Zufriedenheit vorbereitet hatte. Am Anfang war Frau Schlayer so gut wie unsichtbar gewesen, selbst in ihrem eigenen Haus in Berlin-Dahlem. Wenn George dort einzog, wich sie, um nicht zu stören, ins Souterrain aus. Im Molino war ihr zuletzt aber immer häufiger gestattet worden, am Essen teilzunehmen, und manchmal hatte ihr George sogar ein Glas von seinem Wein gereicht oder ihr eine seiner selbst gedrehten Zigaretten angeboten. Mehnert beklagte sich wiederholt, dass die ehernen Ideale des Kreises verraten würden, wenn man der Frau Zutritt zum Innersten gewähre, aber der Meister wiegelte ab: Die Verdienste der »Zuckernen«, wie er sie nannte, seien kolossal.
Claus wäre wohl nicht so weit gegangen wie sein Bruder Alexander, der später, in einem Gedicht zum zehnten Todestag des Meisters, von den »stummen elf«4 am Sterbebett sprach, Clotilde Schlayer also als Vollmitglied zählte. Andererseits gab es für ihn keinen Grund, Frau Schlayer, die Unentbehrliche, die während der letzten Tage gemeinsam mit Kempner Stunde um Stunde am Bett des Meisters ausgeharrt hatte, von der Wache auszuschließen. Allerdings musste Stauffenberg auf die Empfindlichkeiten Mehnerts Rücksicht nehmen, der in geradezu krankhafter Rivalität zu Clotilde Schlayer stand. Deshalb teilte er sie und Walter Kempner für die fünfte Wache Dienstagmorgen 4.30 Uhr ein, sodass Mehnert weder an sie übergeben noch von ihr übernehmen musste. Dass Schlayer und Kempner die Ablösung dann verschliefen, sodass Blumenthal und Anton eine Stunde länger Wache stehen und Alexander und Claus eine Stunde früher raus mussten, bestätigte Mehnert in seinen Vorurteilen gegen Frauen.
Während Stauffenberg noch über die Anordnung der Totenwachen nachdachte und dabei seine Listen ständig umarbeiten musste, weil ihm stets neue Namen zugerufen wurden, eskalierte der Streit in der wichtigsten Frage überhaupt, wo denn der Meister seine letzte Ruhe finden sollte. Auf der einen Seite stand der Haupterbe Robert Boehringer; die andere Seite wurde angeführt von den beiden Nacherben Berthold von Stauffenberg und Frank Mehnert. Mit seiner Auffassung, ein Mensch müsse an dem Ort beerdigt werden, an dem er sterbe, stand Boehringer zunächst ziemlich allein. Am frühen Morgen konnte er sich dann mit seinem Vorschlag durchsetzen, die Meinung der Schwester Georges in Bingen einzuholen. Damit gewann er Zeit und überlistete so die Mehrheit der Freunde, deren Mantra lautete: Ein deutscher Dichter gehört in deutsche Erde!
Wären die politischen Verhältnisse in Deutschland andere gewesen, hätte sich Boehringer diesem Argument wahrscheinlich nicht widersetzt. Aber 1933 gab es unter Georges Freunden viele, die sich für das neue Regime begeisterten und anfingen, Poesie in Wirklichkeit umsetzen zu wollen. Boehringer warnte, dass eine Überführung des Leichnams nach Deutschland unweigerlich das Propagandaministerium auf den Plan rufen werde. Goebbels ließe sich die Gelegenheit sicher nicht entgehen, den Toten, den er zuletzt heftig umworben hatte, mit allem Pomp ins nationalsozialistische Walhalla zu geleiten. Womöglich würde der Sarg von Basel nach Bingen den Rhein hinunter gefahren und zum letzten Geleit am Ufer SA aufmarschieren. Man dürfe in dieser Frage das Heft nicht aus der Hand geben, staatliche Regie sei weder im Sinne des Toten noch im Interesse des Kreises.
Politische Konflikte hatte es im Freundeskreis...