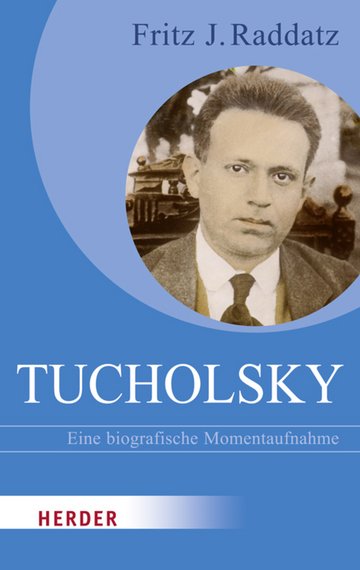Ja, da kann man sich doch nicht nur hinlegen
Ja, da muß man kalt und herzlos sein.
Ja, da könnte so viel geschehen
Ach, da gibt’s überhaupt nur: Nein.
Doch der Jäger hat die Spur aufgenommen, die Witterung. Zu jener Zeit, da es noch keine E-Mail und SMS gab, da es nicht so hurtig hieß: «Gehen wir zu dir oder zu mir?», flirtete man anders; eine Blume, eine Schachtel Konfekt, ein Fläschchen Parfüm – oder ein Gedicht. So sahen die Lockungen Tucholskys aus, der jemandem begegnet war, so ganz und gar anders als die leichten Kurfürstendamm-Eroberungen und leckeren Tingeltangel-Mädchen bisher. So lautete ein Gedicht vom Januar 1918, also zwei Monate nach der ersten Begegnung:
Für Mary
Gibst du dich keinem –?
Bist du nur blond und kühl?
Demütigt dich ein starkes, heißes Gefühl?
Wir sind allein. –
Jeder ist so vom andern durch Weiten getrennt,
daß er nicht weiß, wo es lodert und flammt und brennt –
Wir sind allein. –
Selten nur springt ein Funke von Blut zu Blut,
bringt zur Entfaltung, was sonst in der Stille ruht –
Wir sind allein. –
Aber einmal – kann es auch anders sein –
Einmal gib dich, – und, siehst du, dann wird aus zwein:
Wir beide –
Und keiner ist mehr allein. –
Doch lassen wir Mary, das «Mätzchen», wie er sie später nannte, zunächst selbst erzählen. Wir werden bei der Lektüre ihrer Tagebuchaufzeichnungen zu einer Art Theaterpublikum: Erleben wir doch den Bericht eines Geschehens, das wie auf einer Bühne vor uns seinen Lauf nimmt in Glücksbeginn und Unheilwitterung; nur, daß Akteurin und Berichterstatterin ein und dieselbe Person sind.
Das Theater für diese Inszenierung war eben jene Fliegerschule in Alt-Autz: die Kulissen schäbige Büroräume für die jungen Dienstverpflichteten, die kleine Bibliothek für den «Chef», die Luft des Offizierskasinos geschwängert von Zigarettenqualm, von Cognac- und Rotweindunst, die «Pausen»-Spaziergänge (inklusive kleiner heimlich zugesteckter Leckereien aus der Offiziers-Sonderverpflegung) fanden in der waldbestandenen Umgebung statt – das, was die beiden Hauptakteure «Spazieren auf dem Kriegsschauplatz» nannten. Was wir lesen, ist nicht Monolog einer Lady Macbeth noch Versonnenheitslied einer Ophelia. Was wir sehen, ist das Flattern eines Falters, geblendet vom Licht, verängstigt vom Käscher, angezogen von dem, der ihn nach ihr auswirft – nach ihr, der 19 Jahre jungen Mary.
Sonntag, 11. November 1917
Ich beachte Tucholsky gar nicht. T. zieht schnell die Mütze, winkt mir mit dem Finger und sagt: «Komm her!» – Ich war baff und kümmerte mich nicht um ihn. Beim Vorübergehen sagte er: «Sie haben nicht Ihre eigene Stimme». – «Was ist Ihnen?» frage ich. «Danke, mir ist gut!» Sie haben nicht Ihre Stimme, Sie haben die Stimme von oben. – Ich war sprachlos, zuckte die Achseln und ging fort. –
Montag, 12. November 1917
T. schiebt mir einen Brief zu. Ich lege schnell ein Buch drauf. – Ist der Mensch gerieben! Er sieht sehr gut aus und ist furchtbar mokant. – Als er gegangen war, öffnete ich nach einer Weile den Umschlag, darin war ein mit der Maschine geschriebenes Billet, das lautete: «Man ist begierig, die Stimme noch einmal, länger und ausführlicher, zu hören und bittet um Benachrichtigung, ob man Sie heute abend um 7 Uhr zu ein klein wenig Sekt erwarten darf. Ein kurzer Besuch im Geschäftszimmer der Leihbibliothek – am besten um 12 Uhr – ist willkommen. Mit einem schönen Gruß in ein Paar lustiger Augen. –»
Natürlich ging ich nicht hin.
Dienstag, 13. November 1917
T. sieht durchs Fenster und fragt, ob es in Riga angebracht sei, auf einen Brief nicht zu antworten, weder mit ja noch mit nein. Ich sagte ihm, ich sei nicht gewohnt, von fremden Männern derartige Aufforderungen zu bekommen.
Donnerstag, 15. November 1917
Ich ging absichtlich nicht in die Bibliothek. Um 3 Uhr im Büro übergab mir Ratsch einen Brief von T. Auf dem Kuvert steht: «An 1), 2), 3) und im Brief:
Mary Gerold
Bouquet
Dickerchen
werden gebeten sich nach dem Abendbrot bei mir einzufinden. Zu rauchen gibt es, zu trinken und zu reden, je nach den Geistesfähigkeiten usw.»
– Wir gingen nicht. –
Freitag, 16. November 1917
Bouquet erzählte, sie sei in der Bibliothek gewesen. T. sei wütend, habe gesagt, daß es unfein sei, nicht zu antworten.
Sonnabend, 17. November 1917
Beim Kaffeetrinken sehe ich durchs Fenster und da geht «Dickerchen» (T.) übern Marktplatz. Als ich um 8 ins Büro gehe, kommt er zurück, sehr ernst und sieht sich nicht nach mir um.
Nach dem Mittagessen gehe ich mit Leimann den Weg zum «östlichen Kriegsschauplatz» und – wir treffen Dickerchen. Ich gehe hochnäsig an ihm vorüber. Ich hatte meinen freien Nachmittag. – Es ist kurz vor drei. Dickerchen geht zur Druckerei. Ich rieche den Braten. Es ist 5 nach 3 – ich gehe den Weg zur Kirche. Da sehe ich ihn übern Marktplatz gehen … Und da ist er schon neben mir: «So’n dummer Junge, kaum hat er das Mädel erblickt, so kommt er ihr auch schon nachgelaufen.» – Wir reden und reden, über die Einladung, über Frauen, über «das» …. Morgen um ¼ 5 wollen wir uns auf dem östlichen Kriegsschauplatz treffen.
Abends brachte Ratsch mir ein riesengroßes Kuvert von Dickerchen. Zigaretten und ein Gedicht. Wir sprachen auf unserem Spaziergang über die Deutschen und die Russen, und ich äußerte, daß die Russen viel galanter sind …
Sonntag, 18. November 1917
Nachmittags ging ich mit Ratsch in die Bibliothek zu Dickerchen, um ihm zu sagen, daß ich nicht zu unserer Verabredung käme, weil es regnet. Wir verhandelten lange, bis wir übereinkamen, zu dritt einen gemütlichen Abend zu verbringen. Um 7 Uhr erwartete er uns in der Bibliothek. In seinem Zimmer war der Tisch gedeckt, eine jede hatte eine Tischkarte. Auf meiner stand: «Fräulein Mary Gerold. Guten Appetit und ein fröhlicher Winter!» Der Abend verlief recht ernst. T. widmete sich mehr Ratsch, was mir sehr willkommen war. T. u. ich, wir benahmen uns, als ob wir uns eben kennen gelernt haben. Ich hörte nur zu, denn er erzählt interessant und ist sehr klug. Gut sieht er auch aus, obwohl er keine Erscheinung ist, sein Profil ist großartig: eine hohe gewölbte Stirn, eine schön gebogene Nase, ein sinnlicher Mund und die Augen spitzbübisch! – Sein Gang seine Bewegungen verraten sein übersprudelndes Temperament. –
Als wir im Bett lagen sagt Ratsch zu mir: «Hör, er ist verkracht in dich.» Ich mache das dümmste Gesicht und bestreite das. «Nein», sagt sie, «das fühle ich, du mußt nicht denken, daß ich eifersüchtig bin.» – Als wir uns von T. bei ihm verabschiedeten, küßte er einer jeden die Hand und flüsterte mir zu: «Doch …» –
Montag, 19. November 1917
Ratsch übergab mir einen Brief vom Dickerchen. Er schreibt wieder so nett. – Ich fürchte mich vor seinen weichen, zarten Händen und vor seiner Art mit Frauen umzugehen …
Nachmittags ging ich mit Ratsch zu Dickerchen. Er wollte mit uns spazieren gehen, doch ich wollte mich nicht am hellichten Tag mit ihm zeigen, damit es morgen in aller Mund ist. Er sah es ein. – Ich muß über ihn lachen, er sieht wie ein richtiger Gamin aus, wenn er seine Mütze aufstülpt u. sein pfiffiges Gesicht macht … Aber Mary, du wirst doch nicht Feuer fangen? – Mach keine Dummheiten, sei vernünftig, denk daran: zuletzt ist Leid der Lohn der Liebe …
Mittwoch, 21. November 1917
Um 12 Uhr erwartete er mich und begleitete mich nach Hause. Er bat mich sehr, heute zu ihm zu kommen, ohne Anstandswauwau. Ich ging hin. Er sprach lange und eindringlich auf mich ein, ich saß da und – schwieg, und verstand gar nicht den Kern der Sache. – Die Uhr lag auf dem Tisch – die Zeit verging viel zu schnell.
Freitag, 23. November 1917
Mittags erwartet mich Dickerchen, gratuliert zur neuen Wohnung und übergibt mir ein Päckchen: es ist «Rheinsberg. Ein Bilderbuch für Verliebte» von Kurt Tucholsky. Ich habe es flüchtig gelesen. Zweifellos sind es seine Erlebnisse. «… Mädchen, werft eure Ketten weg – tanzt, tanzt …» Das Buch beschäftigt mich, in jedem Wort erkenne ich ihn.
Als ich Mittwoch bei ihm war und er mich um meine Freundschaft bat, fragte ich – wozu? Als er mich aufs Haar küssen wollte – warum? –
Sonnabend, 24. November 1917
Plötzlich fragt er mich, wie es denn wäre mit einer Bruder- und Schwesternschaft, ich fragte ihn, wie er sich denn das vorstelle: «Natürlich nicht in der Öffentlichkeit, sondern in den wenigen Stunden, die ich ihm schenken werde.» – Ich lehnte es ab. Da fragte er mich, wie ich es mir denn vorstelle … «Ja was denn?» – «Ich will Sie nicht nur als Freundin, ich will Sie ganz.» – Mir war es wie ein Schlag ins Gesicht. Ich hatte alles, was wir bisher geredet hatten, als Scherz aufgefaßt, aber nun fing ich an zu begreifen, daß es ernst war. –
«Ich verstehe Sie nicht.» –
«Ist das Ihr Ernst» – «Ja, mein voller Ernst.» – Er war erregt.
«Ja wie haben Sie sich denn eine Freundschaft zwischen Mann und Frau vorgestellt? ohne das?» –
«Ja, das...