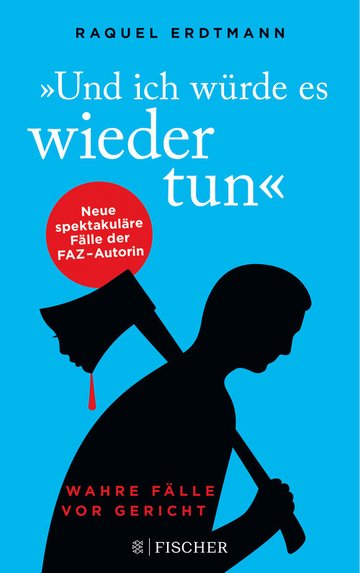43 Jahre Leben
Er hat erfolgreich studiert, in den renommiertesten Unternehmen gearbeitet. Die Kindheit mit Schlägen und Missachtung aber ist zu schwer für ihn zu tragen.
Eines Montagmorgens schafft er es nicht mehr, sich ein Hemd zu bügeln, und bleibt zu Hause. Auch den nächsten, den übernächsten Tag, die nächsten Wochen geht er nicht zur Arbeit – bis man ihm fristlos kündigt. Da nimmt er sich schon längst »jeden Tag aus dem Bewusstsein«. Wenn er den Alkoholpegel erreicht hat, mit dem es ihm gutgeht, läuft der Bankanalyst, der, wie ihm beschieden wird, »überdurchschnittliche Leistungen« erbringt und bald nur noch ein Penner ist, ins Bahnhofsviertel und legt sein Geld in Crack an. Tausende gehen für die Zehn-Euro-Steinchen drauf, bei denen »man ja nie weiß, was da drin ist«. »Man ist dann natürlich schon bekannt: Da kommt der Besoffene, dem verkaufen wir wieder Schrott.«
Irgendwann verbringt er seine Tage »mit den Alkoholikern am Stromkasten« an einer der übleren Ecken des Bahnhofsquartiers, mittlerweile ist er obdachlos. Er schläft in Rohbauten oder im leergeräumten alten Universitätsgebäude. Ob er Arbeitslosengeld, Obdachlosenhilfe angenommen hätte in der Zeit, will sein Verteidiger wissen. »Nein. Das ist generell schwierig, um Hilfe zu fragen.« Er lebt von Supermarktresten und Flaschenpfand, ab und zu klaut er eine Flasche Wodka. Nach einem halben Jahr auf der Straße überwindet er sich und geht zu seinem Vater, zu dem er stets »ein unterkühltes Verhältnis« hatte, zieht in sein altes Kinderzimmer ein, »froh, wieder ein Dach über dem Kopf zu haben«. Arbeitet erst mal seine Post ab, besorgt sich wieder einen Ausweis, meldet sich beim Amt. Das Arbeitslosengeld, das er nun erhält, vertrinkt er am Anfang des Monats »in acht, neun, zehn Tagen«, die anderen zwei Wochen hält er sich clean, treibt Sport, liest Fachliteratur und schreibt nach einer Weile auch wieder Bewerbungen.
Sechs Liter Bier, »die relativ schnell eingenommen werden müssen« und zu denen er nichts essen darf, sind das Minimum, das er braucht, dazu Wodka, wenn möglich. Das Ziel ist, sich schnell auszuschalten.
»Wenn ich diese Mindestmenge nicht zahlen konnte, hab’ ich es gleich gelassen. Wenn ich anfange, war auch immer das Ziel: bis zur Bewusstlosigkeit.« Er bemüht sich, dem Vater aus dem Weg zu gehen, wie auch den Nachbarn im Haus. Auch seine planvollen Alkoholexzesse sollen dem Vater möglichst nicht auffallen, statt in der hellhörigen Wohnung die laute Toilettenspülung betätigen zu müssen, überhaupt ständig auf die Toilette zu gehen, schafft er einen »Liquiditätskreislauf«, wie er es nennt, und pinkelt in die Flaschen.
Der Mann, der vor Gericht all diese Dinge über sich erzählt, tut das mit sachlicher, ruhiger Stimme. Keiner Frage weicht er aus. Konzentriert verfolgt er die Verhandlung in guten Schuhen, schwarzer Hose und weißem Hemd. Die hohe Intelligenz vermittelt sich unmittelbar. Die Herzlosigkeit sich selbst gegenüber ist atemberaubend.
Ein Hochbegabter, in dem sein Vater nur »einen schlechten Maurer« sieht, einen, der nichts kann. Die Mutter stirbt, als er acht ist. Bei einem Weihnachtsurlaub im Schwarzwald wird ein Hirntumor festgestellt, er sieht sie zum letzten Mal an dem Tag, als sie dort ins Krankenhaus kommt. Nach einem halben Jahr ist sie tot. Man lässt das Kind im Unklaren. Aber »wenn der Kioskbesitzer einem schon Heiligenbilder mitgibt, ahnt man, dass was los ist«.
Sein bester Freund aus Kindertagen erzählt, wie ihn die Mutter in die Schule gebracht hat, sie gingen Hand in Hand, inniglich sei das Verhältnis gewesen. Der Vater ist nach ihrem Tod, allein mit dem Kind, überfordert, erzieht mit Schlägen, wirft mit Gegenständen. Geschenke zum Geburtstag gibt es nicht. Feiertage werden nicht begangen. Die Schwester der Mutter, eine Cellistin, ist mit ihrer Karriere beschäftigt. Eine andere Frau gibt es im Leben des Vaters und für den Jungen nicht. Das Kind fürchtet den Vater schon, wenn es nicht Klavier geübt hat.
Als er 13 ist, will sein Vater ihn »schon präventiv schlagen, einfach, weil er annahm, ich hätte etwas vorgehabt«, Verbotenes. Gegen Präventivschläge mit haltlosen Verdächtigungen verwahrt er sich, die körperlichen Attacken bleiben fortan aus. »Deine Mutter hat mich so gebeten, sie zu heiraten«, sagt der Vater eines Tages zu ihm, »so unnötig, so gönnerhaft und so idiotisch, das zu jemandem zu sagen, wenn das Verhältnis schon so schlecht ist.« Er hört sich all den »ganzen Quatsch« an, »sich auszusprechen« hält er nicht für möglich. In der Oberstufenzeit reden beide kaum noch miteinander, er will vom Vater möglichst nicht wahrgenommen werden. Um den Haushalt kümmert er sich.
»Du bist nicht studienfähig, du kannst das nicht«, sagt der Vater seinem Sohn, der sich »immer über Zeugnisse definiert«. Mit links absolviert der sein VWL-Studium, als Jahrgangsbester, heuert in renommierten Unternehmen an, erarbeitet am ifo-Institut Konjunkturprognosen, er hat dort eine Promotionsstelle. »Das wissenschaftliche Arbeiten liegt mir«, gefordert fühlt er sich nicht. »Ich war nix wert, hab aber ganz gut verdient«, urteilt er über sich. Er habe »nicht das Gefühl gehabt, etwas zu leisten, obwohl es ja ein ganz respektabler Job ist«. Das »Konzept der Kollegen mit Heiraten und Kinderkriegen, das hat mich nicht überzeugt«. Getrunken habe er immer alleine zu Hause, beantwortet er die Frage seines Verteidigers, in Kneipen geht er nie. In seiner Münchner Zeit am Institut passiert es ihm auch das erste Mal, dass er sich im Suff nachts einnässt, wie er ungerührt zu Protokoll gibt.
Sein letzter Vorgesetzter, Leiter des Portfoliomanagements eines großen, bekannten Unternehmens, ist als Zeuge geladen. Der Schmerz über den Fall seines ehemaligen Mitarbeiters ist ihm deutlich anzusehen. »Er war der Mann, den wir suchten.« Er hat sich den Geburtstag von ihm gemerkt und jedes Jahr wieder zum Anlass genommen, den Namen zu googeln, in der Hoffnung, »dass er wieder auftaucht«, in einem Unternehmen, in einem Forschungsinstitut. Auch die Kollegen würden bis heute nachfragen, ob er etwas von ihm gehört habe. Der Mann muss brillant und angenehm gewesen sein. Man habe ihm ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt, mit dem er sich überall hätte bewerben können, denn auf der Arbeit sei er schließlich nie wegen Trunkenheit oder Drogen aufgefallen.
»Ich bin kein Psychologe, aber wenn mir nun jemand sagen würde, er litt an Depressionen, würde ich sofort sagen: ja.« Nachdem er schon Wochen bei der Arbeit fehlt, meldet er sich telefonisch. Ist überrascht, noch nicht gekündigt zu sein. »Ich kann nicht mehr«, sagt er seinem Chef. Da haust er längst auf der Straße. »Er war am Ende.« Sein Händedruck mit dem Angeklagten nach seiner Entlassung aus dem Zeugenstand ist bewegt und von Fassungslosigkeit geführt. Die gehörten anerkennenden und zugewandten Worte selbst aus einer Zeit, als er sich schon mit rasender Geschwindigkeit dem Tiefpunkt näherte, bleiben nicht ganz ohne Wirkung auf den Mann, der sich so richtet.
Nicht mal Crack macht ihn aggressiv, im Gegenteil, der Alkohol und die Droge fahren ihn runter. »Ich werde nicht emotional, wenn ich getrunken habe.«
Ob denn nie mal jemand mit ihm über sein Problem gesprochen habe? Die Tante hätte einmal in seinem Zimmer gestanden, hysterisch »Du musst entgiften! Du musst entgiften!« gerufen, antwortet er schulterzuckend. »Entgiften kann ich alleine. Das Problem ist die Zeit danach.« Drei Tage seien schwierig, nach einer Woche geht es ihm immer wieder richtig gut. Ja, aber warum dann wieder anfangen, die unverständigen Fragen der Kammer, offensichtlich frei von Suchtproblemen. Er zuckt wieder mit den Schultern, was soll er dazu sagen? »Es ist eine Sucht« und »Ich denke mal, ich hatte Depressionen«.
Hoffnungslosigkeit kriecht durch den Saal, bleischwer. »Kommen wir zur Tat.« Er nickt bereit. »Wie üblich habe ich meinen Alkoholbesorgungsgang gemacht. Etwas früher an diesem Tag, gegen vierzehn Uhr.« Später musste er noch einmal Nachschub holen, weil er so früh angefangen hatte. Beim Wachwerden am nächsten Morgen – »erstmal orientieren, sich fragen, hab’ ich einen Anschluss, die Erinnerung fehlte ja immer«, so geht es gewöhnlich –, stellte er fest, dass etwas nicht stimmte. Die Zimmertür ist nämlich unüblicherweise offen, er sieht »das Ergebnis«: der Vater tot im Flur, ein Beil daneben. »Ich erinnere, dass ich das aufgenommen habe. Was macht man denn jetzt da?« Er schaut sich in der Wohnung um, ob da noch jemand ist, irgendwo, ob er Einbruchspuren sieht. »War aber nicht. Ratlosigkeit. Die Erklärung für mich: Muss ich gewesen sein. Wer soll es sonst gewesen sein?« Das Beil – die »Einbrecherabwehraxt«, mit der sein Vater seit vielen Jahren, nach einem Hauseinbruch, im Bett schläft.
Mindestens fünfmal, sowohl mit der scharfen als auch mit der stumpfen Seite, ist dem Mann der Schädel mit dem Beil eingeschlagen worden, er stirbt an einem offenen Schädelhirntrauma. Die Hiebe, so der Rechtsmediziner, sind von oben auf einen Liegenden geführt worden. Man rekonstruiert das durch die Blutspritzer. Mehrfach und massiv wurde zugeschlagen, der Schädel ist zerlegt. »Im Prinzip wie beim Holzhacken.«
»Ich glaube ja immer an die Ursache-Wirkung-Geschichte.« Es muss etwas vorgefallen, »irgendeine Schwelle überschritten« worden sein. In der Untersuchungshaft hat er die »Version« entwickelt, er könnte vielleicht, entgegen seinen Gepflogenheiten, aus seinem Zimmer...