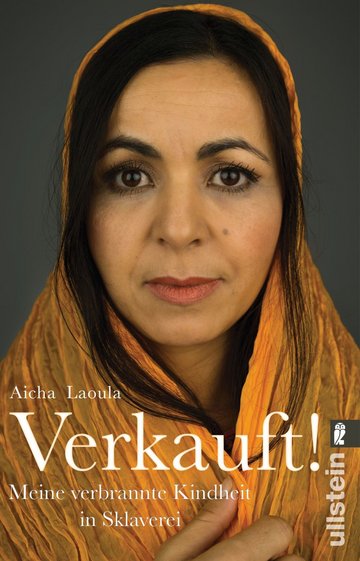Geburt und Tod
Am 23.August 1967 brachte mich meine Mutter auf einer Schilfmatte zur Welt. Zu ihrer Unterstützung war Tante Chttoum an ihrer Seite, die Ehefrau Onkel Bousslams, des verstorbenen, älteren Bruders meines Vaters.
Mein Vater half nicht bei der Geburt, denn unsere Bräuche lassen dies nicht zu. Die Geburt gilt als Sache der Frau, der Mann greift nur im Falle schwerer Komplikationen ein. Tante Chttoum, eine sowohl charakterlich als auch körperlich sehr starke Frau, hatte meiner Mutter bei der Geburt all ihrer Kinder geholfen, und so geschah es auch bei mir: Ich hatte kaum das Licht der Welt erblickt, da wurde ich schon wie ein Bündel in ein Wolltuch eingehüllt, und meinem Vater wurde verkündet, ihm sei ein Mädchen geboren worden. Mein lieber Vater platzte beinahe vor Freude, er nahm mich auf den Arm, hüpfte fröhlich durch das Zimmer und flüsterte mir zu: »Mein Mädchen, oh, wie klein du bist, aber du bist so schön!« Meine Mutter schrie ihm voller Sorge zu, er solle sich beruhigen und vorsichtig sein, da ich so klein und zerbrechlich sei, doch bevor er mich in die Arme meiner Mutter zurücklegte, entschied Vater, mich »Aicha« zu nennen, was »Leben« bedeutet. Dieser Name drückte seinen Wunsch für mich aus, ich möge gemeinsam mit meinen älteren Geschwistern ein langes Leben verbringen.
»Amen, so sei es«, schloss Jamna, unsere Nachbarin, die gekommen war, um zu helfen. Es war eine Ehre, dass ich den Namen »Aicha« am Tag der Geburt erhalten habe. Die Tradition im Dorf besagte nämlich, dass ein Neugeborenes erst nach dem vierzigsten Tag bei seinem Namen genannt werden sollte. Bis dahin wurde das Kind als »der Fremde« bezeichnet. Der Grund dafür war die hohe Sterbensrate Neugeborenerner innerhalb der ersten 40Tage. Um Schmerzen und Leid zu lindern, nahmen vor allem die Mütter emotionalen Abstand zu ihrem Baby, bis die sogenannte »kritische« Zeit vorbei war. Wenn das Kind diese Zeit überlebte, wurde ein Fest gefeiert und es bekam seinen Namen, Geschenke sowie ein herzliches Willkommen in der Gesellschaft.
Ich war, verglichen mit meinen Geschwistern, bei der Geburt besonders zierlich und vielleicht war es das, was in meinem Vater mir gegenüber einen tiefen Beschützerinstinkt weckte. Mein Vater und ich hatten eine starke Bindung zueinander, die erst durch seinen Tod zerbrach.
Mein Vater und meine Mutter, Nachkommen des Volkes der Berber aus dem Südosten Marokkos, lebten in einem kleinen Dorf, das aus sechs Familien bestand. Ringsherum, über das Wüstenland verteilt, gab es viele andere Dörfer, kleinere mit bis zu drei Häusern und größere mit bis zu zehn Häusern. Unser Haus war aus Stein und Lehm gebaut wie alle anderen Häuser auf dem Land, in der Mitte des viereckigen Hauses befand sich ein Hof ohne Überdachung, von dem aus sich die verschiedenen Zimmer mit Flachdach auftaten. Wenn es regnete, war der Hof voller Schlamm, denn der Boden dort und auch der in den Zimmern bestand nur aus befestigter Erde. Es gab weder ein Leitungssystem, noch Zement oder Fliesen – auch elektrischen Strom hatten wir nicht.
Unsere Lebensqualität war vergleichbar mit derjenigen der Menschen im Mittelalter: primitiv und eng mit dem Rhythmus der Natur verbunden. Die Leute befanden sich allerdings im Einklang mit sich selbst, waren ruhig und friedlich. Es herrschte ein unschuldiger Geist, man war gastfreundlich und fröhlich, religiös und dankbar für jede kleine Gabe. Das Wasser mussten wir in Tongefäßen von einem Brunnen holen, der ungefähr einen halben Kilometer weit entfernt lag. Es gab weder Geschäfte noch Apotheken, Krankenhäuser oder einen Arzt. Dafür gab es eine Moschee und eine kleine Schule, einen Kilometer entfernt, wohin einige Jungen geschickt wurden, um Lesen und Schreiben zu lernen.
Zu dieser Zeit wurde auf dem Land die Schule nur von den Söhnen bessergestellter Familien besucht, da sich nicht jeder die Unterrichtsmaterialien leisten konnte. Der größte Teil der Kinder jedoch half der Familie bei der Feldarbeit, zu Hause und bei der Versorgung der Tiere, wobei die Mädchen unter keinen Umständen zur Schule geschickt wurden. Sie lernten vielmehr, Teppiche zu weben, den Haushalt zu führen, auf den Feldern zu arbeiten, die Tiere zu versorgen und auf die jüngeren Geschwister aufzupassen. Kurz gesagt: Sie lernten, brave Hausfrauen zu werden, denn dies war, was in der Zukunft auf sie wartete. Sie lernten auch die Kunst der Unterwerfung: zuerst gegenüber ihren Eltern und dann, wenn sie einmal das familiäre Nest verließen, gegenüber ihrem Ehemann und ihren Schwiegereltern.
Die nächste Stadt, Marrakesch, war ungefähr 200 Kilometer entfernt. Der einzige Autobus, der uns mit dieser Stadt verband, kam nur einmal die Woche bei uns vorbei. Einmal die Woche fand auch der einzige Markt statt – mit wenigen Lebensmitteln und Waren, die mit einem Lastwagen aus der Stadt geliefert wurden.
Das Überleben meiner Familie hing von der Ernte der Gerste für Brot ab, von den Olivenbäumen für Öl, den Bienen, die Honig produzierten, von zwei Kühen für Milch und Butter, den Hühnern für die Eier, von den Kaninchen für ein bisschen Fleisch und von einem Esel, der für die schwerere Arbeit gebraucht wurde. Mein Vater verkaufte etwas von all dem, was er herstellte, auf dem Markt – zusätzlich zu den Teppichen und den Djellabas aus Wolle, die meine Mutter webte.
Im Austausch dafür kaufte er das, was wir benötigten, und außerdem Waren, die er auf den Esel lud und in den Dörfern jenseits der Berge verkaufte – in Orten, die von der Außenwelt abgeschnitten waren und um die es noch schlechter bestellt war als um unser Dorf. In diese gottverlassenen Dörfer kam kein Lastwagen, denn es gab keine Straßen.
Viele dieser armen Leute, die dort wohnten, hatten kein Geld, um die Waren, die sie von meinem Vater kauften, zu bezahlen. Aber er sagte niemals Nein, wenn jemand etwas benötigte. Im Gegenzug gab er Kredite aus, die niemals bezahlt wurden. Manche zahlten mit ein wenig Schafwolle oder mit Gerste und manche auch mit Eiern. Mein Vater wurde von den Menschen sehr geliebt für sein großes Herz und seine Menschlichkeit. Er war ein Mensch voller Liebe.
Meine Mutter hingegen kümmerte sich um das Haus, ging Wasser holen, suchte Zweige und sammelte trockenen Mist, um Feuer zu machen und zu kochen. Niemand besaß Holz, denn das Land war eine Wüste, voller steiniger Hügel, Berge, roter und gelber Erde: trotz der Dürre ein wundervolles Stück Natur. Es regnete nur während des Winters ein wenig, aber wenn es regnete, wurde alles grün, und die Blumen blühten. Bäume gab es wenige, abgesehen von den Olivenbäumen, die in der Nähe der einzigen Wasserquelle wuchsen, die am Fuße eines Berges entsprang. Hier und da gab es ein paar Mandelbäume, einige wenige Feigenbäume und einige Kaktusfeigenpflanzen.
Alles in allem war es unser Glück, in der Nähe der Quelle zu wohnen, denn so konnten wir einen kleinen Garten anlegen, in dem wir ein wenig Gemüse anbauten.
Ich war mittlerweile zwei Jahre alt, meine größeren Brüder, der achtjährige Hmad und der sechsjährige Hussein arbeiteten auf den Feldern mit und hüteten die Tiere. Saina mit ihren vier Jahren half im Haus und passte auf mich auf. Ich war der Liebling meines Vaters, und wir waren unzertrennlich. Oft konnte ich es kaum erwarten, bis er von der Arbeit zurückkam und ich ihm in die Arme fallen konnte. Wir waren eine unbeschwerte und glückliche Familie und hatten, im Vergleich zu anderen Familien, ausreichend zu essen.
Eines Abends, als mein Vater von den Feldern der Tante Chttoum zurückkam, wo er den Tag mit Pflügen verbracht hatte, wurde er plötzlich von stechenden Magenschmerzen befallen.
»Sidi-Rebbi-nou!«, schrie meine Mutter, »Sidi-Rebbinou! Was hast du? Geht es dir schlecht?«
»Ich muss mich hinlegen! Mein Magen! Er brennt! Ich vergehe vor Qualen!«, klagte er und hielt sich die Hände vor den Bauch, während er sich vor Schmerzen krümmte.
»Was hast du gegessen? Hast du etwas getrunken, als du unterwegs warst?«, fragte meine Mutter flehend.
»Nein, nichts außer dem Kaffee, den mir Chttoum nach der Arbeit angeboten hat.«
Mein Vater sollte sich von seinen plötzlichen Beschwerden nicht mehr erholen.
Er wurde zu ein paar Heilern gebracht, die ihn mit Pflanzen- und Kräuterextrakten behandelten, allerdings ohne nennenswertes Ergebnis. Der El-Fekeh, der Lehrer des Heiligen Korans in unserem Dorf, hatte ihm eine Kette mit einer kleinen Papierrolle mit verschiedenen heiligen Versen umgehängt, er hatte ihn die Dämpfe der Verse einatmen lassen, als er sie langsam über dem Feuer verbrennen ließ, und letztlich hatte er es mit Aufgüssen versucht, er ließVater Wasser trinken, in dem er die heiligen Verse aufgelöst hatte, die er mit der Asche von verbrannter Schafwolle auf ein Stück Papier geschrieben hatte.
Innerhalb weniger Wochen verlor mein Vater die ehemals gesunden und kräftigen Zähne, da sich das Zahnfleisch ablöste. Die Pflege meiner Mutter, die seinen ganzen Körper mit Olivenöl einrieb, um sein Leiden zu lindern, brachte ebenfalls nichts. Nach ein paar Wochen war von dem so starken und robusten Mann, der er gewesen war, nichts außer einer mitleiderregenden und sterbenden körperlichen Hülle übrig geblieben. Vater war die medizinische Pflege, die er wirklich gebraucht hätte, versagt geblieben: ein gut ausgestattetes Krankenhaus und moderne Medizin. Um ihn in ein Krankenhaus zu bringen, war es viel zu spät, und außerdem war dies unmöglich, denn meine Familie konnte sich – wie viele andere – die Fahrt in die Stadt nicht leisten, von den Kosten für die medizinische Behandlung ganz zu schweigen. Mein armer Vater verlor so innerhalb kurzer Zeit seinen quälenden Kampf gegen den Tod.
Von dem Tag an, an dem...