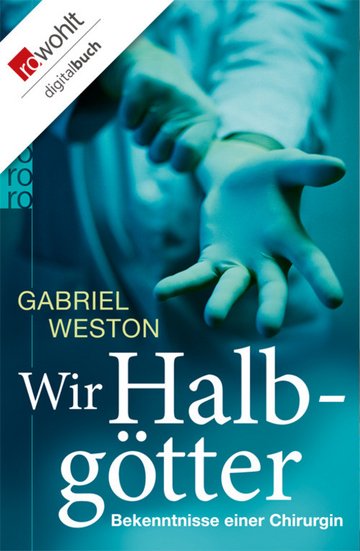Sex
Um ein guter Arzt zu sein, muss man einen Spagat hinbekommen: Man muss so viel Nähe zu einem Patienten entwickeln, dass er einem etwas erzählt und man auch versteht, was er meint. Man muss aber auch genug Abstand wahren, um emotional nicht zu sehr einzusteigen. Der Abstand bietet beiden Parteien Sicherheit. Ein Arzt kann es sich nicht leisten, beim Anblick von Blut ohnmächtig zu werden oder sich bei übelriechenden Fäzes übergeben zu müssen. Und dass der Doktor in Tränen ausbricht, ist das Letzte, was jemand will, der gerade richtig schlechte Neuigkeiten erfahren hat. Manchmal aber nimmt man das Ähnliche zwischen einem selbst und dem Patienten stärker wahr als das Trennende. Manchmal zeigt einem der eigene Leib, wie sensibel er ist, wie er mitfühlt mit dem Menschen, den man gerade untersucht, oder das eigene Herz schießt quer und macht sich bemerkbar, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann. Zu den schwierigsten Dingen, die man im Krankenhausalltag lernen muss, gehört der Umgang mit dem Sexuellen. Das ist, als mache man die Pubertät noch einmal durch.
Als ich zum ersten Mal den Penis eines Fremden anfasste, war es glücklicherweise der eines narkotisierten Patienten. Dem alten Mann, der bewusstlos aus dem Anästhesieraum in den OP gefahren worden war, sollte wegen eines Karzinoms ein Teil des Dickdarms entfernt werden: eine lange Operation, zu deren Überwachung man einen Harnblasenkatheter legt.
Ich war Ärztin im Praktikum. Ich war zwar sehr gern im OP, hatte aber noch nicht so recht meinen Platz darin gefunden. Ich stand verlegen in einer Ecke, als mein Kollege, ein attraktiver Facharzt, sagte, ich solle mich doch einbringen. Ich willigte begeistert ein, gab zu, mit dem Vorgang dieser Operation noch nicht vertraut zu sein, und war dankbar, als er sich bereit erklärte, mir zu zeigen, was ich tun sollte. Eine Schwester richtete einen Wagen mit allen Instrumenten her, die wir benötigten, und der Adonis und ich traten vor den nackten Leistenbereich des Patienten.
Ich streifte mir ein Paar sterile Handschuhe über. «Eine Hand», erläuterte mir der Adonis, «ist sauber. Eine Hand ist schmutzig. Mit der schmutzigen Hand tupfen Sie den Penis ab.» Ich hatte Mühe, gewisse Phantasien über mich und diesen Chirurgen beiseitezuschieben, die die beiden Wörter «schmutzig» und «Penis» bei mir auszulösen drohten, und wurde rot. Als erstes wusch ich die Eichel des Patienten.
Das Grüppchen des OP-Personals amüsierte sich über mein offensichtliches Unbehagen, als der Chirurg fortfuhr: «So, jetzt mit dieser Hand den Penis ruhig halten. Und mit Ihrer sauberen Hand» – die Erleichterung, nicht ständig das Wort ‹schmutzig› hören zu müssen, ließ meine Röte etwas verblassen – «nehmen Sie das Lidocain-Gel und führen es in den Kanal ein.» Nervös nestelte ich mit der Hand – die, welch ein Jammer, ja doch nie mit dem Chirurgen in Berührung kommen würde – an dem schlaffen Glied des Patienten, und das Anästhetikum aus der Ampulle verschwand nicht, wie erhofft, in seinem Penis, sondern ergoss sich auf seinen Unterbauch. Erfahren in solchen Situationen und blind für romantische Anwandlungen amüsierte sich der Adonis über meine Ungeschicklichkeit. «Erst die Vorhaut zurückziehen, dann den Katheter einführen.» Kein Penis, dafür lauter Vorhaut – die Aufgabe schien unlösbar. Die rutschige Vorhaut lag gar nicht, so schien es, auf etwas auf, von dem man sie hätte zurückschieben können, sodass das Ende des fußlangen Katheters immer wieder aus der sackartigen Eichel des Penis herausflutschte und ich mit jedem beherzten Schub Gel verspritzte. Krankenschwestern und OP-Kräfte kicherten. Der Adonis sagte schneidend: «Ich dachte, das können Sie besser. Es wird doch wohl nicht Ihr erster Penis sein?» «Mein erster schlaffer, doch!», war alles, was ich in der Aufregung entgegnen konnte.
Schließlich führte der Adonis die Arbeit für mich zu Ende, aber noch Wochen später fingen überall im OP erfahrene Chirurgen an zu kichern, wenn sie sich erinnerten, dass ich diejenige war, die verkündet hatte, sie sei das Hantieren mit steiferen Gliedern gewohnt.
Eine andere peinliche Begegnung, bei der ich mich in die Präpubertät zurückversetzt fühlte, ereignete sich während eines Bereitschaftsdienstes. Ich wurde gebeten, mir einen postoperativen Patienten anzusehen, der unter Phimose litt. Das sind schmerzhafte Beschwerden, die auftreten, wenn die Vorhaut für längere Zeit über die Glans penis zurückgezogen wird. Das Bändchen der zurückgezogenen Haut wirkt wie eine Aderpresse und verhindert den Blutabfluss aus dem Penis, der sich schmerzhaft aufbläht. Im Krankenhaus kann es dazu kommen, wenn eine Schwester oder ein Arzt nach dem Einführen eines Katheters vergessen hat, die Vorhaut wieder zurückzuziehen.
Es war mitten in der Nacht, als ich auf die orthopädische Station kam und sofort ein leises Stöhnen ausmachte, das sich von den allgemeinen Schmerzgeräuschen unterschied. Steve, der stämmige Oberpfleger, brachte mich zu Mr. Ashtons Bett, zog den Vorhang um mich und den Patienten und ließ uns mit aufmunterndem Zwinkern allein. Das eingegipste Bein auf einem Kissen, hatte Mr. Ashton vor Unruhe den Kopf in den Nacken geworfen. Sein geschwollener, verfärbter Penis hob sich wie ein dunkler Leuchtturm vor dem Horizont des Lakenrandes ab.
Er war ein junger Mann. Wir waren etwa gleich alt. Unter anderen Umständen wäre ich ihm vielleicht auf einer Party begegnet – ein Gedanke, den ich mir gleich wieder aus dem Kopf zu schlagen versuchte. Ich war fast dankbar, dass er Schmerzen hatte, weil so keine Peinlichkeit zwischen uns aufkommen konnte. Mr. Ashton sah mich verstört an und wimmerte leise. Ich begann, ruhig auf ihn einzureden, nicht weil es nachtschlafende Zeit war, sondern weil ich wollte, dass er mich ansah, merkte, wie ruhig ich war, und daraus schloss, dass ich behutsam sein würde, denn ich erklärte ihm nun, dass ich gleich seinen wunden Penis in die Hand nehmen und ihn drücken würde. Kaum hatte ich «drücken» gesagt, da fügte ich schon «ganz, ganz sacht» hinzu, ohne jedoch näher auszuführen, dass ich den Druck immer mehr verstärken würde, so lange, bis ich das gestaute Blut proximal verteilt hatte, anschließend die Vorhaut lösen und alles wieder an seinen Platz bringen konnte.
Ich nahm seinen nächsten Wimmerlaut als Zustimmung und umfasste mit der Hand, Finger für Finger langsam fest schließend, so viel von der Spitze seines Penis, wie ich konnte. Es fühlte sich an, als berührten wir zwei uns kaum. Mr. Ashton holte im selben Moment Luft; womöglich erleichtert, seine schlimmsten Befürchtungen über rachsüchtige Frauen nicht bestätigt zu sehen. Nach und nach verstärkte ich nun den Druck, erst so weit, dass die kleinen Muskeln meiner Hand sich in ihrer noch halb gedehnten Position entspannen konnten, dann noch mehr. In merkwürdiger Umkehrung anderer ähnlicher Berührungen registrierte ich befriedigt, dass das, was ich umfasst hielt, zu schrumpfen begann. Noch immer steigerte ich behutsam meinen Druck. Nach ungefähr fünf Minuten umklammerte ich Mr. Ashtons Penis mit aller Kraft. Sowie das restliche gestaute Blut vom Ende seines Organs hinaufgewandert war, ließen seine Beschwerden nach, und was vorher wie quälender Schmerz ausgesehen hatte, wich jetzt nackter Scham. In der künstlichen Dunkelheit der Station waren wir mit einem Mal bloß noch zwei einander fremde junge Leute, von denen einer den Penis des anderen hielt.
Mr. Ashton dankte mir und konnte offensichtlich kaum erwarten, dass ich ging. Ich war zufrieden, dass ich die Sache gut erledigt hatte, und wollte mich selbst auch rarmachen. Steve machte, wie zu erwarten war, irgendeine flapsige Bemerkung, als ich die Station verließ, und ich wurde zu einer anderen Aufgabe gerufen.
Der Penis kommt am Arbeitsplatz von Medizinern auch auf subtilere Art ins Spiel. Noch ehe ich überhaupt daran dachte, Ärztin zu werden – ich studierte damals Literatur an einer Universität im Norden –, bat einmal einer meiner Dozenten seinen Bruder, der Chirurg war, um Hilfe bei der Renovierung seiner Küche. An dem Abend, als der handwerklich Begabte in der Stadt ankam, war ich zu einer kleinen Studentenparty im Haus des Dozenten eingeladen. Es gab Fleisch, und der angereiste Bruder aß viel davon. Wir unterhielten uns mit Junge-Leute-Geschichten aus der Zeit zwischen Schule und Studium, über die postkartengroßen Abenteuer, die wir bisher erlebt hatten. Gegenüber seinen Schilderungen von Schneiden und Schuften im OP nahmen sich unsere klein und albern aus. Dieser Mr. Silk hatte ein paar Fotoalben im Auto liegen, die er uns beim Kaffee zeigte. Sie waren voller Vorher-nachher-Bilder: vorher der Tumor, nachher eine glatt sich dehnende Partie Fleisch, vorher ein komplizierter Bruch, nachher gerichtete Gliedmaße mit fein vernähter Haut. Am Ende der Mahlzeit schälte Mr. Silk vor unseren Augen einen Apfel, und wir schauten zu, als sich die Schale in einem schmalen, perfekt geringelten Streifen von der Frucht löste.
Mit zweiundzwanzig staunte ich darüber und wurde, da ich dem Bruder meines Dozenten den ganzen Abend aufmerksam zugehört hatte, mit der Aufforderung belohnt, ihn in seinem OP zu besuchen, wenn ich wieder einmal in London war. Ohne Zögern nahm ich an.
Keinen Monat später fuhr ich mit dem Zug gen Süden, um das Wochenende bei einer Tante zu verbringen. Am Samstag stand ich frühmorgens auf und gelangte mit der ersten U-Bahn zu Mr. Silks privat betriebenem Operationstrakt. Ich war sehr aufgeregt, als man mich in den Damen-Umkleideraum...