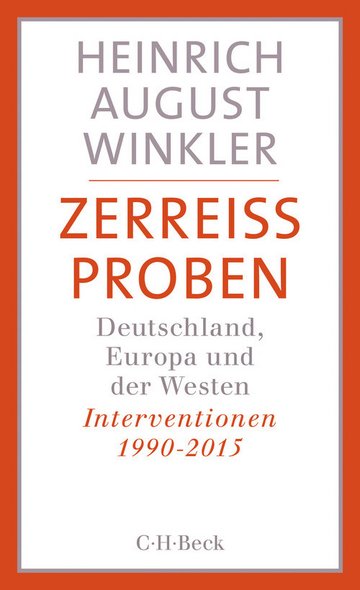Der unverhoffte Nationalstaat.
Deutsche Einheit:
Die Vorzeichen sind günstiger als 1871
28. September 1990
I.
Marx mag tot sein, aber die Dialektik lebt. Jedenfalls ist die Geschichte noch immer gut für überraschende Volten und schwer auflösbare Widersprüche. Jahrzehntelang haben die Deutschen sich an den Gedanken gewöhnt, daß es mit dem Ende ihres Nationalstaates seine historische Richtigkeit habe und die Lösung der deutschen Frage infolgedessen keine nationalstaatliche mehr sein könne. Fast über Nacht fällt ihnen jetzt in den Schoß, woran sie kaum mehr geglaubt, worauf sie auch nicht hingearbeitet haben: ein neuer deutscher Nationalstaat. Werden die Deutschen mit dieser unverhofften Entwicklung fertig werden?
In keinem anderen europäischen Land ist die Skepsis gegenüber dem Nationalstaat so groß wie in Deutschland. Der Grund liegt auf der Hand: Nirgendwo ist der Nationalstaat auf so furchtbare Weise gescheitert wie hier. Der deutsche Nationalstaat, das 1871 von Bismarck gegründete Reich, hat sich selbst zerstört, bevor er nach dem zweiten der von ihm ausgelösten Weltkriege von den Siegern besetzt und schließlich geteilt wurde. Dem äußeren Untergang von 1945 war zwölf Jahre zuvor der innere vorausgegangen. Mit der Übertragung der Macht an Hitler am 30. Januar 1933 endete nicht nur die kurzlebige erste deutsche Demokratie, die Republik von Weimar, sondern auch der sehr viel ältere deutsche Rechts- und Verfassungsstaat. Das Ende des deutschen Nationalstaates hätte sich nur noch aufhalten lassen, wenn es den Deutschen gelungen wäre, sich aus eigener Kraft von der Diktatur Hitlers zu befreien.
Der äußere Untergang des Deutschen Reiches war eine Folge seiner totalen militärischen Niederlage. Der innere Untergang hatte seine tieferen Ursachen in den Widersprüchen der Nationalstaatsgründung von 1871. In der Revolution von 1848/49 war der Versuch der Liberalen und Demokraten fehlgeschlagen, gleichzeitig die Einheit und Freiheit Deutschlands zu verwirklichen. Bismarcks Reichsgründung, nach seiner eigenen Meinung wie der der Zeitgenossen eine «Revolution von oben», brachte den Deutschen die ersehnte Einheit – in der «kleindeutschen» Form, also unter Ausschluß Österreichs. Diese Lösung der deutschen Frage war nicht nur mit den Interessen des übrigen Europa verträglicher als ein noch mächtigeres «Großdeutschland». Sie entsprach auch den Wünschen der Liberalen nordwärts des Mains und vor allem in Preußen: Sie waren zumeist evangelisch und sahen im katholischen Vielvölkerstaat der Habsburger ein klerikales, wirtschaftlich rückständiges, national nicht integrierbares Gebilde, kurz ein Relikt des Mittelalters.
Aber die Freiheit im Sinne eines parlamentarischen Systems und damit der politischen Vorherrschaft des liberalen Bürgertums konnte und wollte Bismarck den Deutschen nicht gewähren. Er erfüllte nach dem Sieg über Österreich im Jahre 1866 jene liberalen Forderungen, die mit den Interessen der altpreußischen Führungsschicht – Dynastie, Adel, Armee und hohes Beamtentum – vereinbar waren. Das liberale Bürgertum konnte sich in Kultur und Wirtschaft frei entfalten und der Gesetzgebung weitgehend seinen Stempel aufdrücken. Das Zentrum der staatlichen Macht jedoch, die eigentliche Regierungsgewalt, blieb ihm in Bismarcks konstitutioneller Monarchie versperrt.
Die Nationalliberalen, wie sich der kompromißwillige Flügel der liberalen Bewegung nannte, wußten sich zu trösten: «Ist denn die Einheit nicht selbst ein Stück Freiheit?» fragte einer ihrer Wortführer, Ludwig Bamberger, im Dezember 1866 in einem Aufruf an die Wähler Rheinhessens.[1] Für die deutsche Einheit eintreten, das hieß aus der Sicht der Liberalen, aber auch der jungen Arbeiterbewegung, für Freiheit und Fortschritt, gegen die vielen Dynastien und ihren adligen Anhang sein. Die nationale Parole war bis in die Reichsgründungszeit ein Kampfruf der Liberalen und der Linken. Aber die Nationalliberalen trugen selbst dazu bei, daß nach 1870/71 der freiheitliche Glanz dieser Parole rasch verblaßte. Während des «Kulturkampfes», den sie im Bunde mit Bismarck führten, scheuten sie nicht davor zurück, die kirchentreuen Katholiken als Deutsche zweiter Klasse, ja als «Reichsfeinde» zu diffamieren. Mit demselben Begriff wurden die Sozialdemokraten bedacht, die Bismarck von 1878 bis 1890 mit Hilfe eines von den Nationalliberalen gebilligten Ausnahmegesetzes verfolgte.
Der Begriff «national» verwandelte sich seit Mitte der 1870er Jahre von einer linken in eine rechte Parole. Sie diente dem Kampf gegen die international gesinnte Sozialdemokratie und gegen die liberale Freihandelslehre, der der «Schutz der nationalen Arbeit» in Gestalt hoher Einfuhrzölle entgegengestellt wurde. Antisemitische Agitatoren machten hinter der «roten Internationale» der Arbeiter und der «goldenen Internationale» des Bankkapitals einen gemeinsamen Drahtzieher aus: das internationale Judentum. National sein hieß fortan in erster Linie antiinternational und sehr häufig auch bereits antisemitisch sein.
Der deutsche Nationalstaat hat die inneren Feindbilder seiner Entstehungsphase nie völlig überwunden. Den Sozialdemokraten half es nur wenig, daß sie im August 1914 dem Reich Kriegskredite bewilligten und wie alle Deutschen zu den Fahnen eilten. Noch in den Jahren der Weimarer Republik galten sie in den Augen «nationaler» Kreise als «vaterlandslose Gesellen». Auch gegenüber den Katholiken gab es in der ersten deutschen Demokratie fortdauernde Vorbehalte. Sie waren so stark, daß ein katholischer Politiker wie Heinrich Brüning, der Reichskanzler der Jahre 1930 bis 1932, sie nur durch einen forcierten Nationalismus glaubte entkräften zu können.
Die Republik von Weimar, wie sie aus der Revolution von 1918/19 hervorging, erscheint uns rückblickend als ein Versuch, den Hauptwiderspruch des Kaiserreiches, den Gegensatz zwischen kultureller und wirtschaftlicher Modernität auf der einen und der Rückständigkeit des politischen Systems auf der anderen Seite, zu überwinden. Gegen das Gelingen dieses Versuches stand eine doppelte Erbschaft der Monarchie: die Abneigung großer Teile der traditionellen Eliten gegen die neue Mehrheitsherrschaft und das Unvermögen vieler Demokraten, sich auf die Kompromisse einzulassen, ohne die ein Vielparteienstaat nicht parlamentarisch regiert werden konnte. Der Übergang zu einem vom Reichspräsidenten gestützten Notverordnungsregime im Jahre 1930 markiert das Ende Weimars als parlamentarische Demokratie und die Rückkehr zu einer bürokratischen Spielart des Obrigkeitsstaates.
Doch das Rad der Geschichte ließ sich nicht einfach zurückdrehen. Seit sechs Jahrzehnten waren die Deutschen an das allgemeine gleiche Wahlrecht für Männer gewöhnt, und seit 1918 bedurften die Regierungen des Vertrauens des Reichstags, mittelbar also auch der Bevölkerung. Daß die Präsidialregierungen ab 1930 den Willen der Massen auszuschalten suchten, mußte massenhaften Protest auslösen. Das wirkungsvollste Sprachrohr dieses Protests waren die Nationalsozialisten. Die Partei Hitlers appellierte gezielt an beides: den überlieferten Anspruch der Massen auf politische Teilhabe und an das verbreitete Ressentiment gegenüber dem neuen, angeblich undeutschen parlamentarischen System, das den Willen des Volkes verfälsche. Was die Nationalsozialisten der parlamentarischen Demokratie und dem Präsidialregime entgegensetzten, war ein System, das sie als Ausdruck des wahren Volkswillens ausgaben: der plebiszitär legitimierte Führerstaat.
Deutschland war das einzige hochindustrialisierte Land, das im Verlauf der Weltwirtschaftskrise sein demokratisches System aufgab und durch eine totalitäre Diktatur ersetzte. Ohne die Langlebigkeit des Obrigkeitsstaates oder, anders gewendet, die verspätete Demokratisierung Deutschlands ist dieser «Sonderweg» nicht zu erklären. Gewiß läßt sich im historischen Vergleich nirgendwo ein «Normalweg» zur liberalen Demokratie erkennen, und so gesehen ist alle Geschichte eine Geschichte von Sonderwegen. Aber im Hinblick auf die deutsche Entwicklung darf man hinzufügen: Einige dieser Sonderwege sind noch besonderer als die anderen.
II.
Eine der Voraussetzungen für Hitlers Erfolg war die allgemeine Überzeugung, daß Deutschland keine größere Schuld am Ersten Weltkrieg auf sich geladen hatte als die anderen kriegführenden Mächte, der Vertrag von Versailles also schreiendes Unrecht war. Zwar belegten die seit 1919 bekannten deutschen Dokumente die kriegstreibende Rolle der Reichsleitung in der Julikrise von 1914 zur Genüge, aber das behinderte nicht die Verbreitung einer Kriegsunschuldlegende – der ebenbürtigen Schwester jener Dolchstoßlegende, wonach «marxistische» Verräter der kämpfenden Front in den Rücken gefallen seien und damit Deutschlands militärische Niederlage herbeigeführt hätten. Nach dem Zweiten Weltkrieg bestritten nur kleine Gruppen von Unbelehrbaren, daß dieser Krieg vom nationalsozialistischen Deutschland entfesselt worden war. Diese Einsicht erleichterte den moralischen...