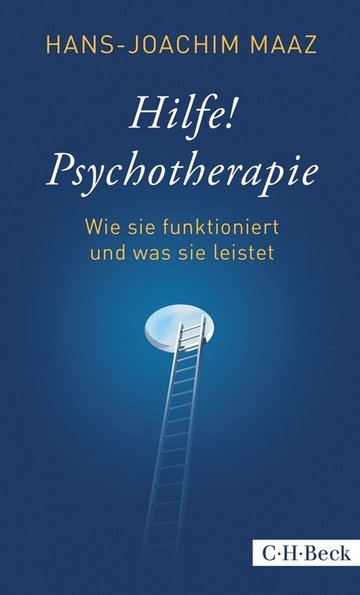2
Die therapeutische Beziehung
Doch nun zur therapeutischen Beziehung selbst: Eine psychotherapeutische Behandlung muss der Patient bei seiner Krankenkasse beantragen, der gewählte Therapeut diese fachlich begründen, ein Gutachter den Antrag befürworten – und die Krankenkasse bewilligt schließlich die zu honorierende Behandlung. Diese hat die letzte Entscheidung, sie kann auch eine vom Gutachter nicht befürwortete Behandlung bewilligen oder eine befürwortete verweigern. In aller Regel folgen die Kassen aber der gutachterlichen Empfehlung.
In unserem Buch beziehen wir uns ausschließlich auf die psychodynamischen Psychotherapien: auf die tiefenpsychologisch fundierte und die analytische. Der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Behandlungen liegt in der für einen Erfolg gebotenen Zielstellung, im Behandlungssetting (siehe S. 52ff.) sowie in der Methodik der Therapie. Die Verhaltenstherapie wird von uns nicht bedacht, weil wir keine ausreichenden Erfahrungen damit haben.
Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie verfolgt eine lediglich begrenzte Zielstellung. Ausgehend von einer aktuellen Symptomatik oder sozialen Krise, wird auf die innerseelischen Konflikte oder Persönlichkeitsprobleme des Patienten fokussiert, deren Inhalte und Wirkungen ihm anfangs noch nicht verständlich sind, da sie unbewussten seelischen Vorgängen entstammen. Das Behandlungsziel bleibt also auf eine aktualisierte Problematik begrenzt, deren Ursachen und Folgen geklärt werden sollen, damit der Patient einen Ausweg aus seiner Belastungssituation finden kann. Therapeut und Patient einigen sich auf einen Behandlungsschwerpunkt und kommen in der Regel einmal pro Woche für 50 Minuten zur Therapie zusammen. Der mögliche Behandlungsumfang wird von den Krankenkassen in Bewilligungsschritten bestätigt: 25 – 50 – 80 und maximal 100 Stunden.
Eine analytische Psychotherapie hat eine allgemeinere und umfassendere Zielstellung; deshalb sind auch die Bewilligungsschritte der Krankenkassen wesentlich weiter gefasst: 80 – 160 – 240 und maximal 300 Stunden, die in aller Regel zwei- bis dreimal pro Woche absolviert werden. Die Therapie zielt auf die gesamte Persönlichkeitsproblematik eines Patienten, sie muss deshalb die komplette Entwicklungs- und Lebensgeschichte berücksichtigen. Die gestörten Beziehungsformen sollten möglichst in der Übertragung zum Therapeuten erkennbar werden, um diese dann in ihrer Entstehungsgeschichte mitsamt den Folgen zu verdeutlichen und gefühlsmäßig zu verarbeiten. Dadurch gewinnt der Patient Erfahrungen, um günstigere Beziehungsmöglichkeiten zu finden. Eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie bietet sich also an, wenn ein begrenzter Konflikt behandelt werden kann (konfliktorientierte Therapie), eine analytische Psychotherapie dagegen, wenn eine therapeutische Veränderung der Gesamtpersönlichkeit des Patienten angestrebt wird (strukturorientierte Therapie).
Es gibt zunehmend Tendenzen, sehr wirkungsvolle Techniken und Methoden aus psychotherapeutischen Verfahren, die aber nicht als Richtlinien-Verfahren anerkannt sind, zum Beispiel aus der Körperpsychotherapie, der Gestalttherapie oder der Katathym-imaginativen Psychotherapie, in die tiefenpsychologisch fundierte und die analytische Psychotherapie zu integrieren. Das wird auch von uns praktiziert. Die Traumatherapie ist ebenfalls kein Richtlinien-Verfahren, jedoch lassen sich mittlerweile traumatherapeutische Techniken in die Richtlinien-Verfahren integrieren, sofern das psychodynamische Grundverständnis für die Behandlung gewahrt bleibt. Neben traumatisierenden Erlebnissen müssen nämlich immer auch die entwicklungs-, konfliktdynamischen und strukturbedingten Störungen berücksichtigt werden.
Was Psychotherapie eigentlich ist und wie sie wirkt beziehungsweise was sie bewirkt, ist vielen unverständlich. Es ist auch schwer zu erklären. Exakte Aussagen dazu sind kaum möglich, das Objektivierbare bleibt spärlich. Psychotherapie ist und bleibt – darin liegt ihre Faszination – etwas subjektiv Menschliches, ein Beziehungsgeschehen zwischen zwei Menschen (in der Gruppe zwischen mehreren Menschen), ein intersubjektiver Vorgang mit einer kaum jemals genau vorhersehbaren Dynamik. Nie kann Psychotherapie als ausreichend sicher, als richtig oder falsch, als geboten oder verboten, als wirklich hilfreich oder doch hinderlich eingeschätzt werden. Das subjektive Erleben, die Wirkungen und die Folgen der Begegnung zwischen Patient und Therapeut geben jedoch wichtige Informationen über den Wert der Beziehung und mithin auch der Therapie. Für den Therapeuten erwächst daraus Erfahrungswissen, das für seine Arbeit in der Regel wichtiger ist als alle Theorie. Dass Psychotherapie wirkt, ist wissenschaftlich gesichert. Ihre individuelle Anwendung aber bleibt eine Kunst und ist von ganz subjektiven Wirkfaktoren abhängig.
Beziehung ist demnach das Schlüsselerlebnis für die psychotherapeutische Arbeit. Beziehung aber entzieht sich letztlich allen Manualen, allen Regeln und Vorschriften und insbesondere erlernbaren Techniken. Therapeutische Methoden und Interventionen sind nicht an sich wirksam, sondern nur Vehikel, die Beziehung transportieren. So kann dieselbe therapeutische Technik bei verschiedenen Patienten sehr unterschiedliche Reaktionen zeitigen. Auch wird eine gelernte therapeutische Technik von jedem Therapeuten anders verstanden und angewendet. Therapeuten lernen natürlich Methoden, aber sie sind gut beraten, darin nur Hilfsmittel zu sehen, wie sie mit Patienten in eine hilfreiche Beziehung kommen.
Was aber ist hilfreich? Auch das bleibt eine Sache subjektiver Bewertung. Patienten und/oder Therapeuten können eine Entwicklung als sehr hilfreich erleben, die sich letztlich dann doch als Sackgasse erweist. Der Therapeut handelt etwa nach seiner theoretischen Überzeugung (er gibt eine ihn selbst überzeugende Deutung) und ist zufrieden bis stolz auf seine erlernten Fähigkeiten. Aber wie seine Deutung beim Patienten ankommt und verstanden wird, liegt nicht in seiner Macht. Oder der Patient fühlt sich in einer Abwehrleistung vom Therapeuten bestätigt – zum Beispiel in einer Behauptung wie: «Das stimmt für mich so, das lasse ich mir auch nicht ausreden!» – und erlebt die therapeutische Zusammenarbeit als hilfreich. Aber in Wirklichkeit wird er nur in einer verzerrten Wahrnehmung oder trotzigen Haltung bestärkt und damit an tieferer Einsicht gehindert.
Hilfreich ist also nicht gleich hilfreich. Die subjektive Einschätzung kann durchaus ein Symptom der neurotischen Störung sein, und zwar gleichermaßen beim Therapeuten wie beim Patienten. Wir müssen mehr Zweifel und Unsicherheit bei der Beurteilung zulassen, annehmen, dass unser Wissen nie ausreichend sicher ist, und auf den Verlauf, die Entwicklung warten. Genauso müssen wir aber auch zu unerwarteten Erkenntnissen und schmerzlichen Einsichten bereit sein und die Zusammenarbeit immer wieder neu daraufhin justieren, was der Patient wirklich sucht, braucht und aushält und was der Therapeut noch verstehen, akzeptieren und verkraften kann.
Dabei sind stets die Wirkungen therapeutischer Erkenntnis und Veränderung zu berücksichtigen. Wie wird jemand mit neuen Einsichten und vor allem mit den Reaktionen wichtiger Bezugspersonen auf sein verändertes Verhalten fertig? Psychotherapie geschieht nicht in einem luftleeren Raum, sondern immer in einem sozialen Netzwerk, das nicht nur aus Nahestehenden, sondern auch aus sozialen Regeln und Zwängen besteht. Was zunächst subjektiv als richtig und befreiend erlebt wird, kann im sozialen Kontext als gefährlich und sehr belastend erfahren werden. Die Kräfte, die ursprünglich zu neurotischen Fehlentwicklungen geführt haben, sind keineswegs nur in den Eltern, sondern darüber hinaus in vielen Personen und Strukturen der sozialen Realität verkörpert.
So nimmt das systemische Denken in der Psychotherapie einen wichtigen Raum ein. Ein leidender Mensch ist aus dieser Perspektive eben nicht nur ein Individuum mit belastenden Erfahrungen, sondern ein Teil in einem belastenden System, das etwa die Partnerschaft, die Familie, das Arbeits- und Berufsmilieu, die soziale Gruppe und natürlich die Gesellschaft mit ihren Normen, Geboten und Verboten einschließt. Der einzelne Patient ist dann Symptomträger des pathogenen Systems. Infolgedessen glauben er selbst und das soziale Umfeld, es handele sich um einen Kranken in sonst normalen Verhältnissen. Eine verhängnisvolle Kurzsicht! Denn wenn es dem Einzelnen gelingt, seine individuellen Symptome zu überwinden, wird er in der Regel für alle wesentlichen Bezugspersonen erst recht zum Problem. Denn jetzt wird das Gestörte bei den «Normalen» deutlich – jedenfalls für den Patienten erkennbar –, und nicht selten entbrennt daraufhin ein heftiger Konflikt, der den ehemals Kranken erneut zum Symptomträger eines gestörten Beziehungssystems macht. Oder er lässt den mittlerweile Gesundeten zum Kritiker von jenen Personen seiner Umwelt werden, deren Verhalten er als problematisch beziehungsweise gestört erkannt hat. Nicht selten zerbrechen daran Partnerschaften, Familienmitglieder gehen auf Distanz, bisherige Arbeitsverhältnisse werden nicht mehr akzeptiert. Die Abnormität gesellschaftlicher Verhältnisse lässt sich nicht länger übersehen. Es gibt eine alte psychoanalytische Weisheit, die sinngemäß...