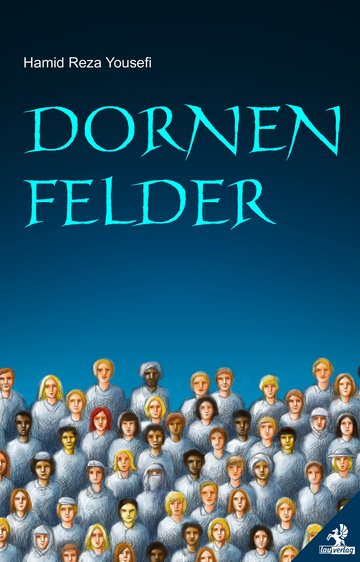Teil 1
Steinige Wege
Ankunft in einer Parallelgesellschaft
Meine erste Station in Deutschland war die Main-Metropole Frankfurt. Im Iran dauert es in der Regel sehr lange, bis ein Visum ausgestellt werden kann, dies ist auch mit tausenden von Eventualitäten verbunden. Weil ich nicht warten wollte, entschied ich mich, es über die Türkei zu versuchen. So fuhr ich zunächst mit einigen Freunden in einem Bus nach Istanbul. Nachdem wir die iranische Grenze passiert hatten, kauften sich einige Passagiere Whiskey und türkisches Bier, da im Iran kein Alkohol konsumiert werden darf. Vom Atatürk-Flughafen aus wollte ich eine Maschine nach Frankfurt am Main nehmen. Im Bus entwickelten sich einige Bekanntschaften unter Iranern, die ebenfalls nach Deutschland reisen wollten, und wir schlossen uns zusammen, um mit einem Dolmush, einem Omnibus, den Flughafen zu erreichen.
Im Kreise von Landsleuten, debattierenden Männern und lachenden Frauen, mit denen ich lustige Worte wechselte, ging ich an Bord einer Maschine nach Deutschland. Nach unserer Ankunft wünschten sie mir alles Gute. Wir verabschiedeten uns herzlich bei der Passkontrolle, bevor sie verschwanden und ich mutterseelenallein in der Halle eines mir fremden Flughafens stand. Die Gespräche der Vorbeieilenden verstand ich nicht.
In diesen Wochen des ungewissen Unterwegsseins bewegte ich mich zwischen drei unterschiedlichen Kulturformen, dem Iran als einem Land, in dem Frauen Kopftücher trugen, der Türkei, in der die Haare der Frauen zu bewundern waren und Deutschland, wo die Mädchen bekleidet waren wie zur Schahzeit im Iran, mit Miniröcken und Hemdchen mit Spaghettiträgern. Zum ersten Mal wurden mir drei unterschiedliche Transformationen der Kulturen bewusst. In kürzester Zeit schlüpfte ich, wie ein Fisch, von einem kulturellen Kontext in den nächsten.
In Frankfurt wandte ich mich an Bijan, einen Bekannten aus meiner Teheraner Heimatstadt. Bevor er neun Jahre vor mir den Iran wegen des Iran-Irak-Krieges verließ, hatte er mit seiner Familie unweit von uns gelebt, so dass sich oft unsere Wege kreuzten. Als ich den Plan fasste, nach Deutschland zu kommen, wollte ich mich zuerst an ihn als meine erste Anlaufstelle wenden. Seine Eltern stellten mir seine Adresse und Telefonnummer zur Verfügung.
Als ich nach einigen Telefonaten, die ich aus der Türkei mit Bijan geführt hatte, plötzlich in Deutschland vor ihm stand, schauten wir uns lange an. Es war ein denkwürdiger Augenblick, dass sich zwei ehemalige Nachbarskinder, die sich kaum mehr erkannten, aus einem weit entfernten Teil der Welt hier begegneten: erhebend und gruselig, ein seltenes Gefühl des Aufgehobenseins und der Verlassenheit zugleich. Mir gingen in diesem Moment viele Geschichten unserer Jugend durch den Kopf. Plötzlich sagte Bijan: »Hamid, to-i?«, ›bist du es?‹
»Are manam«, ›ja, ich bin’s‹, erwiderte ich, glücklich ein Wort in meiner Muttersprache zu hören.
»Willkommen zu Hause«, begrüßte er mich und wir umarmten uns fest. Bijan sagte mir: »Du bleibst hier, und ich werde mich um deine Angelegenheiten kümmern. Ich kenne mich hier sehr gut aus und habe auch bisweilen als Dolmetscher gearbeitet.« Mir fiel ein riesengroßer Stein vom Herzen.
Bijan war sechsundzwanzig Jahre alt und etwas mollig, so dass seine Freunde ihn ›Tschaqalu‹, Moppelchen, nannten. Er beherrschte zwar sehr gut die deutsche Sprache, bewegte sich aber in einer ghettoartigen Parallelgesellschaft. Seine Gutmütigkeit machte ihn beliebt; mir schien er auf eine sympathische Art unordentlich. Er hatte immer eine Schar iranischer und anderer ausländischer Freunde um sich, seine deutschen Nachbarn aber schien er kaum zu kennen. Dies war mir ungewohnt, weil die Nachbarn im Iran in der Regel wie zur Familie gehörig behandelt werden. Weil bei Bijan fast immer laute Musik lief, fragte ich ihn, ob sich die Nachbarn nicht auf die Dauer gestört fühlten:
»Nein nein, sie reden mit uns nicht, selbst dann nicht, wenn wir richtig auf die Pauke hauen. Sie wollen, dass es uns nicht gibt«, zwinkerte er mir, halb belustigt, halb ernst, zu.
Bijan lebte in den Tag hinein und sprach, meinem Empfinden nach, zu sehr dem Alkohol zu. Am Abend suchten ihn seine Freunde mit Bier, Asbach-Flaschen und Kartoffelchips auf, man trank und starrte gebannt auf die Mattscheibe, wo die gerade auf Sendung gegangene Stripshow ›Tutti Frutti‹ lief. Man verkündete lautstark, wie gerne man mit dem Moderator Hugo Egon Balder tauschen würde und bewunderte die mit Blümchen beklebten Busen der spärlich bekleideten Damen. Das war der Höhepunkt ihres nächtlichen Vergnügens. Diese Art der Unterhaltung und der Euphorie ihrer Zuschauer, ein ausschweifendes Leben ohne Perspektive, fand ich nicht gerade nachahmenswert.
Mich machte nachdenklich, dass Bijan und seine Freunde überhaupt nicht bemüht waren, die Angebote der Gesellschaft zu nutzen, um sich weiterzuentwickeln. Es war mir ein hoffnungsvoller Gedanke, hier ein sinnvolles Leben zu gestalten und mich soweit wie möglich einzugliedern. Mir war es urplötzlich ein Bedürfnis, ein Gespräch mit meinem Gastgeber zu suchen. Dies ließ nicht lange auf sich warten.
Einige Tage später bat ich Bijan darum, mich nach Bad Schwalbach zu fahren, wo ich mich als Asylsuchender melden konnte. Als wir uns voneinander verabschiedeten, sprach ich an, was mir seit unserem Wiedersehen auf dem Herzen brannte:
»Du sprichst sehr gut Deutsch und bist ein aufgeschlossener Mensch, warum trinkst du eigentlich so viel und führst dieses Leben? Ist es dir gleich, was mit dir geschieht? Ist dir die Zukunft egal oder tust du nur so?«
Er war sichtlich ergriffen.
»Hamid«, setzte er schließlich an, »du wirst wahrscheinlich das Gleiche erfahren oder dir wird vielleicht das Gleiche widerfahren. Es ist nicht einfach, in dieser Gesellschaft zu bestehen, egal, was du machst. Ob du lieb oder böse bist. Du läufst so nebenher.« Unvermittelt brach Bijan in Tränen aus: »Ich bin seit 1981 in Deutschland, wegen des Iran-Irak Krieges. Zum Militär wollte ich nicht, meine Eltern wollten das auch nicht, und da sie einigermaßen wohlhabend sind, ermöglichten sie mir die Ausreise.« Er erzählte, dass auch er über die Türkei seinen Weg nach Deutschland gefunden hatte, und fuhr fort: »Dabei dachten wir, ich lande nun im Paradies. Mittlerweile sehe ich aber keinen Unterschied zwischen beiden Ländern. Hier tragen die Leute eine Krawatte, dort einen Stehkragen, hier werden Menschen belogen, dort auch; hier kannst du bis zum Abwinken saufen, dich in der Öffentlichkeit mit Mädels verlustieren; das Gleiche machst du im Iran, aber eben zu Hause. Alles ist letzten Endes gleich; nur Formen und Methoden sind unterschiedlich. Was aber dazukommt, so bist du hier letzten Endes der ungeliebte Ausländer, den man nicht ernst zu nehmen braucht. Das ist alles.«
Manche Leute hielten ihm immer wieder vor, dass Ausländer nicht nur Deutschland auf der Tasche liegen, sondern auch die deutsche Kultur missachteten, indem sie ihre eigenen Spielchen auf deutschem Boden austrugen. »Keiner interessiert sich, warum du hier bist, dass Du ein Mensch bist, der anders ist«, fügte er hinzu.
Ich spürte das Dramatische an seiner Situation, war aber voller Optimismus und sagte: »Einfach alles gleichzusetzen ist nicht richtig. In Deutschland wie im Iran gibt es viele gute Dinge, aber auch sehr viele Schwierigkeiten. Man muss doch wenigstens versuchen, mit dieser Gesellschaft klarzukommen! Nein, Bijan, erst, wenn das nicht funktioniert, kannst du ja wieder in den Iran zurückgehen. Kulturen können schlecht sein, aber du musst auch daran arbeiten, um sie besser zu machen.«
»Na, du wirst schon sehen, vielleicht schaffst du es ja besser als ich, hier zu recht zu kommen«, schloss er das Gespräch.
Von Heim zu Heim …
Das Durchgangswohnheim in Bad Schwalbach war ein Riesenkomplex mit Einzelgebäuden, in denen sich zahlreiche Räumlichkeiten befanden. Es sah wie eine verkommene und gottverlassene Kaserne aus, die jenseits von Gut und Böse ist, und war völlig verschmutzt. Wegen der permanenten Ankunft und Abreise zahlreicher Menschen herrschte eine unbeschreibliche Dauerhektik. Das Procedere war einfach: es gab ein Anmeldezentrum mit mehreren Büros. Jeder Sachbearbeiter hatte einen Übersetzer bei sich und war, in alphabetischer Reihenfolge, für die Ankommenden zuständig.
Zunächst sprach Bijan für mich, die weiteren Befragungen aber mussten mit einem eigenen Übersetzer der Behörde erfolgen. Die erste Vorsprache entsetzte mich, weil man mich, wie einen Kriminellen, von allen Seiten fotografierte und mir die Abdrücke von allen zehn Fingern genommen wurden.
Nach dieser Anmeldung brauchten die Beamten einige Zeit, um uns auf die umliegenden Wohnheime aufzuteilen. Alle mussten stets ganz Ohr sein, weil man immer über Lautsprecheranlagen ausgerufen wurde und zu gewissen Uhrzeiten bei bestimmten...