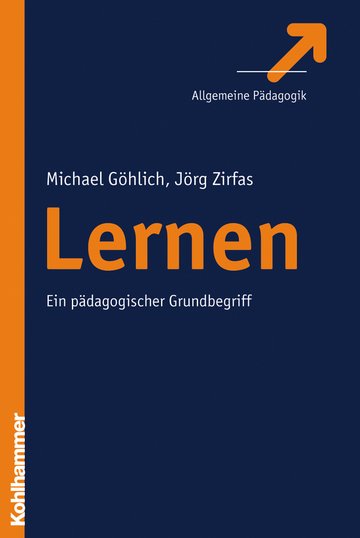2 Zugänge
Behaviorismus
Der Lernbegriff wurde im 20. Jahrhundert vor allem vom Behaviorismus geprägt, einer Theorie, die menschliches Verhalten als naturwissenschaftlich untersuchbar und erklärbar ansieht, es in Reiz-Reaktions- bzw. (Re-)Aktions-Konsequenz-Ketten zu zerlegen sucht und auf die Heranziehung innerpsychischer Vorgänge zur Erklärung von Verhalten verzichtet.
Die lang anhaltende Hegemonie des Behaviorismus ist gut an Hilgards (in späteren Auflagen: Hilgard/Bower) Übersichtswerk Theories of Learning (1948) zu erkennen, mit dem mehr als eine Generation amerikanischer Psychologen groß wurde. Aus ihm stammt die oft zitierte Definition des Lernens als »der Vorgang, durch den eine Aktivität im Gefolge von Reaktionen des Organismus auf eine Umweltsituation entsteht oder verändert wird« (Hilgard/Bower 1970, S. 16). Es wurde bis in die 1980er Jahre immer wieder neu aufgelegt und wirkte – zumal seit der deutschen Übersetzung von 1970 – auch auf den deutschsprachigen Diskurs. Das Werk stellt vor allem behavioristische Ansätze vor, so etwa die Lerntheorien von Thorndike, Pawlow, Guthrie, Skinner, Hull und Tolman. Andere Ansätze wie die Gestalttheorie, Lewins Feldtheorie und Freuds Psychoanalyse werden ebenfalls behavioristisch gelesen, d. h. der behavioristische Standpunkt wird als die disziplinäre Konvention der Psychologie (der implizit die Definitionshoheit über den Lernbegriff zugeschrieben wird) angesehen, auf die hin andere Ansätze (als übereinstimmend oder abweichend) zu überprüfen sind. Zudem kündigt sich in ihm bereits früh die Erwartung der behavioristischen Lerntheorie an die Neurophysiologie an, exakte physiologische und anatomische Korrelate des Lernens zu zeigen.
Bis heute wird die Lernpsychologie durch diese Verbindung behavioristischer Ansätze mit Rückgriffen auf neurophysiologische Befunde bestimmt. Als Beispiel hierfür mag das unter Psychologie-Studenten verbreitete Lehrbuch Lernpsychologie (Edelmann 2000) dienen, das mit der Darstellung hirnbiologischer Grundlagen von Lernen und Gedächtnis beginnt, dann ausführlich das Reiz-Reaktions-Lernen und das instrumentelle Lernen behandelt, bevor schließlich – hier ist die kognitive Wende (s. u.) schon vollzogen – auch auf Begriffsbildung, Handeln und Motivation eingegangen wird.
Auch wenn der Behaviorismus seinen Namen einem Aufsatz des amerikanischen Psychologen John Watson verdankt (Watson 1913), ist er ohne die Vorarbeiten der deutschen Assoziationspsychologie (v. a. Ebbinghaus) und vor allem der russischen Reflexologie (v. a. Pawlow) nicht denkbar.
Die Assoziationspsychologie interessierte sich für etwas, das man heute vielleicht am besten als »mechanisches Lernen« bezeichnen kann. Ebbinghaus untersuchte das Erlernen, wir könnten auch sagen: Auswendiglernen, sinnloser Silben (z. B. Tak, Pir, Gan) und stellte dabei seine berühmte »Vergessenskurve« auf. Kern seiner Lerntheorie war die Annahme einer unmittelbaren assoziativen Verknüpfung psychischer Elemente im Bewusstsein.
Die Reflexologie und die darauf aufbauende Theorie der klassischen Konditionierung, in der Fachliteratur auch als Signallernen, reaktives Lernen oder Reiz-Reaktions- bzw. Stimulus-Response-, kurz: S-R-Lernen, bezeichnet, geht hingegen von der Annahme der bewusstseinsunabhängigen Verknüpfung eines Reizes mit einem anderen bzw. eines Reizes mit einer Reaktion aus. Belege hierfür bieten Pawlows Versuche mit einem Hund, in dem ein unbedingter Reflex (hier: Maulbewegungen und Speichelproduktion als Reflex auf Säurezuführung) mit einem in zeitlicher Nachbarschaft auftretenden Reiz (hier: Glockenton) assoziiert wird, so das dieser zunächst neutrale zu einem bedingten Reiz wird, der Signalfunktion für den (nun bedingten) Reflex hat. Lernen in diesem Sinne ist Reizassoziation und vollzieht sich bewusstseinsunabhängig. Diese Auffassung machte sich auch John Watson, der Namensgeber des Behaviorismus, zu Eigen und suchte ihre Gültigkeit für menschliches Lernen in dem berüchtigten Experiment mit dem neunmonatigen Albert zu belegen, hinter dessen Rücken immer dann auf eine Eisenstange geschlagen wurde, wenn er mit seiner weißen Ratte spielte, bis er schließlich bereits beim Anblick der Ratte zu schreien begann, auch ohne dass das Geräusch erzeugt werden musste.
Hier deuten sich die ethische Problematik und der in dieser Hinsicht blinde Fleck an, die mit der Hegemonie des behavioristischen Modells den psychologischen Blick auf das Lernen prägen. Hierzu passt, dass ein anderes, immer wieder aufgelegtes Lehrbuch der Psychologie, welches diese – ganz im Sinne des Behaviorismus – als Wissenschaft vom Verhalten definiert, die Behauptung aufstellt, das »endgültige Ziel der Psychologie« sei »die Kontrolle des Verhaltens« (Zimbardo 1983, S. 35). Allerdings war es weniger die klassische Konditionierung und damit das Konzept des Reiz-Reaktions-Lernens als die Theorie der operanten Konditionierung bzw. des instrumentellen Lernens, die dem Behaviorismus zur hegemonialen Stellung im Diskurs um menschliches Lernen verhalf.
Angelegt war diese zweite große behavioristische Lerntheorie, die mit den Arbeiten Skinners in den 1950er Jahren ihren Durchbruch erzielte, in gewissem Sinne schon bei Thorndike. Seine Formel »Lernen am Erfolg«, auch Lernen durch Versuch und Irrtum (trial and error) genannt, hat weniger einen Reiz als vielmehr die Konsequenz eines Verhaltens im Blick, man könnte auch sagen: Die Konsequenz ist der Reiz.
Diese Theorie wurde von Skinner weitergeführt. Gelernt wird seiner Auffassung nach, was erfolgreich und nützlich ist, d. h. Verhaltensweisen, die einen angenehmen Zustand herbeiführen oder bewahren.
Skinners Theorie versucht sich jeglicher Begriffe zu enthalten, die Erlebnisse beschreiben. Aussagen wie z. B., dass ein Individuum bestimmte Konsequenzen seines Verhaltens erwartet oder befürchtet, hält Skinner für nicht zulässig. Dementsprechend wendet er sich gegen die Einführung beobachtungserklärender theoretischer Annahmen wie etwa des Konzepts der Motivation. Wissenschaftstheoretisch gesehen sucht Skinners Behaviorimus im Grunde lediglich Bedingungen für eine Veränderung der Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens zu erfassen.
Auf dieser Grundlage entwickelte Skinner sein Konzept des operanten Konditionierens. Er unterscheidet zwischen Antwortverhalten (als solches bezeichnet er das vom klassischen Konditionieren fokussierte Geschehen, also eine Reaktion auf einen Reiz) und Wirkverhalten. Letzteres ist ein zunächst spontanes Verhalten. Skinner geht also durchaus vom aktiven Menschen aus und überschreitet damit die Prämisse der S-R-Lerntheorie. Die Aktivität eines Menschen muss ihm zufolge nicht erst durch äußere Reize angeregt werden, sondern ist in der Regel Wirkverhalten, d. h. auf die Umwelt wirkendes und durch diese Wirkung bestimmtes Verhalten.
Als operante Konditionierung bezeichnet er die Konditionierung eben dieses Wirkverhaltens. Durch operantes Konditionieren erzeugtes Lernen wird heute meist als instrumentelles Lernen bezeichnet. Bei instrumentellem Lernen steht also Verhalten mit nachfolgenden Ereignissen (Wirkungen) in Verbindung. Wie im Reiz-Reaktions-Lernen aus einer unbedingten eine bedingte Reaktion wird, so wird im instrumentellen Lernen aus einem wirkungsoffenen ein wirkungsgebundenes Verhalten. Jede minimale Verhaltensänderung in Richtung des (in den Tierversuchen wie auch in der später darauf aufbauenden Verhaltenstherapie als extern, d. h. von einer anderen Person kontrollierbar gedachten) Endverhaltens wird gleich verstärkt. Ein zentraler Begriff der Theorie instrumentellen Lernens lautet Kontingenz. Gemeint ist damit – passend zur wissenschaftstheoretischen Position Skinners (s. o.) – ein hoher Grad an Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Umweltereignisse von einer bestimmten Verhaltensweise abhängen.
Aus dieser behavioristischen Perspektive sind im Wesentlichen vier Formen instrumentellen Lernens möglich, nämlich die positive und die negative Verstärkung – die beide zum Aufbau eines bestimmten Verhaltens führen – sowie die Bestrafung und die Löschung – die beide zum Abbau eines bestimmten Verhaltens führen. Während die Bestrafung seit der Antike Bestandteil des Diskurses um Lernen ist und der Begriff der positiven Verstärkung (mit dem ein Lob, die Gabe einer Süßigkeit o. ä. bezeichnet wird) in den letzten Jahrzehnten ebenfalls in die Alltagssprache Eingang gefunden hat, blieben die Begriffe der negativen Verstärkung (mit dem der Entzug eines unangenehmen Ereignisses bezeichnet wird) und der Löschung (bei der dem Verhalten weder eine angenehme noch eine unangenehme Wirkung folgt) der Alltagssprache fremd.
Aufgegriffen wurden sie vom therapeutischen Diskurs, in den der behavioristische Zugang in Form der Verhaltenstherapie(n) früh Eingang fand und in dem er sich hierzulande spätestens mit der gesetzlichen Zulassung der Verhaltenstherapie als von den Krankenkassen anzuerkennende Therapieform etabliert hat. Als Verhaltenstherapie werden all jene therapeutischen Verfahren bezeichnet, die auf eine Veränderung des gegenwärtigen Verhaltens abzielen. Die Aufdeckung unbewusster seelischer Konflikte wird – im Gegensatz zur Psychoanalyse – ausdrücklich nicht zum Ziel erklärt. Die Modifikation des Verhaltens soll stattdessen durch Konditionierung im Sinne der behavioristischen Lerntheorie erreicht werden. So wird z. B. bei Phobien die schrittweise Annäherung an das gefürchtete Objekt oder die gefürchtete Situation mit der gleichzeitigen Ausführung angsthemmender Tätigkeiten wie etwa Entspannungsübungen verbunden.
Die –...