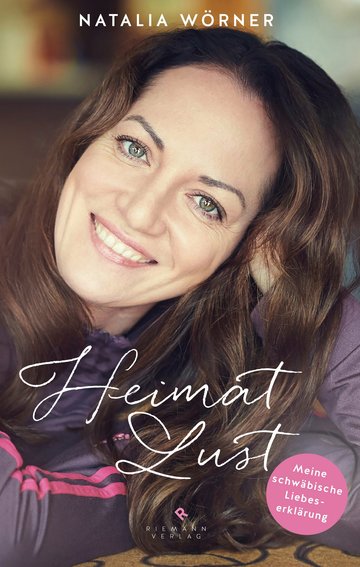Mein Auftritt im ZDF-Dreiteiler »Tannbach« ist kurz: Zum Ende des Zweiten Weltkriegs rücken Amerikaner ins Dorf Tannbach ein, dessen Name frei erfunden ist, doch an ein reales Vorbild angelehnt wurde, dem Ort Mödlareuth zwischen Bayern und Thüringen. Die Gemeinde wurde 41 Jahre durch die innerdeutsche Grenze geteilt, was ihr den Namen »Little Berlin« eintrug. In »Tannbach« spiele ich die Gräfin Caroline von Striesow, deren Mann Georg an der Front desertiert ist und sich verborgen hält. Als das rauskommt, weigere ich mich, sein Versteck preiszugeben, worauf mich ein noch immer vom Endsieg überzeugter Nazi hinrichten lässt.
Nach meinem Filmtod wird erzählt, was in Geschichtsbüchern lückenhaft abgedeckt ist. Die Amerikaner ziehen ab, dafür kommen Russen. Sie vergewaltigen Frauen, erschießen Einwohner, etablieren ihr politisches System. Dann wechseln auf beiden Seiten der neuen Grenze Altnazis flugs die Uniform, schlüpfen nahtlos in neue Ämter. Bei der Aktion »Ungeziefer« werden Menschen ohne Rücksicht zwangsumgesiedelt, Familien auseinandergerissen. Von einem menschlichen Sozialismus, auf den nach dem Sündenfall des Tausendjährigen Reiches viele ihre Hoffnung setzten, ist nichts zu spüren. In diesem Film geht es um Schuld, Sühne und Heimat, drei Begriffe, die nicht voneinander zu trennen sind. Die Heimat der Menschen von Tannbach wird durch die Grenze zwischen den deutschen Staaten geteilt: Auf der einen Seite herrscht von nun an der Kommunismus, auf der anderen Seite der Kapitalismus, hier Ostblock, dort Westen. Selten ist ein Heimatkonflikt eindringlicher gezeigt worden und die Hilflosigkeit derer, mit diesem Schicksal fertig zu werden. Für mich war es nicht leicht, die Rolle der Gräfin an der Seite von Heiner Lauterbach als Georg zu spielen, da eine persönliche Erinnerung geweckt wurde. Auch der Vater meiner Mutter hieß Georg. Er fiel zum Ende des Zweiten Weltkriegs auf rätselhafte Art und Weise, und Gerüchte und Wahrheit vermischten sich in den Erzählungen über ihn. Wahrscheinlich wurde er von rumänischen Widerstandskämpfern getötet, doch niemand weiß Genaues. Damit setzte ich mich während der Dreharbeiten auseinander und gleichzeitig mit der Frage, was Heimat an dieser willkürlich gezogenen deutsch-deutschen Grenze bedeutete.
In Mödlareuth und anderen Orten nahe der Mauer und des Todesstreifens prallten zwei verschiedene Lebensentwürfe aufeinander. Mir fiel eine Geschichte ein, die sich im Mittleren Schwarzwald zugetragen haben soll. Lange Zeit gehörte dieser Landstrich zu Österreich, wurde dann von Napoleon dem Königreich Württemberg zugeschlagen und kam nach einem Gebietstausch zum Herzogtum Baden. In einem Bauernhaus auf der wechselvollen Grenze änderte sich dadurch von Generation zu Generation die Konfession. Mal war man katholisch, mal evangelisch, dann wieder katholisch. Wenn Heimat nicht nur bedeutet, an einem Ort zu leben, sondern die Möglichkeit bietet, diesen zu gestalten, wirft Mödlareuth und der Schwarzwaldhof die Frage auf, welchen Einfluss wir überhaupt nehmen.
Ich erinnerte mich an die Erzählungen von Uroma Moni, die Ähnliches 2000 Kilometer weiter östlich in Kiew erlebte. Oder sollte ich Kyjiw schreiben, wie es in der Ukraine üblich ist, oder die russische Schreibweise Kijew verwenden, schließlich gilt diese Stadt seit der Zeit der Kiewer Rus als Mutter aller russischen Städte? Manche, die über Kiew berichten, ziehen die polnische Orthografie vor, weil die Stadt am Dnjepr im Mittelalter das Zentrum des Vielvölkerstaates Polen-Litauen war, in dem eine außergewöhnliche Religionsfreiheit herrschte, der viele noch heute nachtrauern. Heimatgefühl beginnt damit, welcher Sprache wir uns bedienen. Für Uroma Moni war das eine zentrale Frage: Ihr Vater, ein bedeutender Kaufmann namens Kommerell aus Tübingen, war 1879 mit seiner Frau nach Kiew ausgewandert. Dort gründeten sie einen großbürgerlichen russisch-schwäbischen Haushalt, in dem die Sprache stets Stimmungen unterworfen war.
Ähnliches sollte ich Jahrzehnte später selbst erleben. Stritt sich meine Großmutter mit meiner Mutter, wechselten die beiden vom Deutschen ins Französische, schließlich sollten meine Schwester und ich nicht mitkriegen, welche Laus ihnen über die Leber gelaufen war. So wurde Französisch für mich zur Sprache des Streits. Erst in der Zeit, als ich selbst in Paris lebte, lernte ich sie auch als Sprache der Liebe kennen.
In Kiew begann Moni mit der Arbeit an einem kulinarisch-sinnlichen Kochbuch, das zum Schrecken ihrer Nachkommen werden sollte. Niemand von uns verstand es, ihre blumigen Andeutungen uralter Kochrezepte in handfeste Anweisungen umzudeuten. Russische und deutsche Worte wechselten sich munter ab, bei den Mengenangaben war abwechselnd von Gramm und Kilos die Rede, dann wieder von Pud und Berkowitz.
Als Moni Cannstatt längst zu ihrer neuen Heimat auserkoren hatte, wanderte das Kochbuch von einem Regal zum anderen, wurde immer wieder hervorgekramt und kopfschüttelnd zurückgestellt, bis es irgendwann auf geheimnisvolle Weise verschwand, und damit die Erinnerung an eine Heimat, die keiner von uns kannte. Wie Moni nach Deutschland gekommen war, darüber sprach sie nur ungern. Ihre älteren Schwestern Klara und Susanne hatten Ukrainer geheiratet, was sie unter Stalins Diktatur verdächtig machte. Zusammen mit dem Vater wurden sie 1915 nach Sibirien verschleppt, wo sich die Spur der Frauen verlor. Der Vater kam drei Jahre später durch einen glücklichen Umstand frei und floh mit Moni in den Westen. Zunächst verschlug es die beiden nach Friedrichshafen am Bodensee, damals schon eine bedeutende Industriestadt mit dem Luftschiffbau von Ferdinand von Zeppelin, der Luftfahrzeug-Motorenfabrik von Wilhelm Maybachs ältestem Sohn Karl, der Zahnradfabrik und den Dornier-Werken. Hier hatte Moni keinesfalls vor, das Leben einer Dulderin zu führen. Ihren langen Zopf schnitt sie ab, noch bevor sie ihren Mann kennenlernte, der den Namen Felix trug, ihm jedoch wenig Ehre zu machen verstand, da er alles andere als »vom Glück begünstigt« war.
Irgendwann kamen Kinder, zwei Söhne, die man Georg und Julius taufte. Da lebte die Familie bereits in Stuttgart. Felix war langweilig, hockte gerne am Ofen, was sich Moni nicht allzu lange ansah. Bald ging sie mit einem anderen Mann aus, der etliche Jahre älter war, noch zu Hause bei seiner Mutter lebte, den Beruf eines Bankangestellten ausübte, doch am liebsten über Literatur und Musik dozierte. »Ein echter Hagestolz«, erzählte Uroma später mit verschmitztem Lächeln auf dem Gesicht. Ich musste den Ausdruck erst nachschlagen. Ein Hagestolz taucht in Goethes »Faust« auf, wo es heißt: »Der Hagestolz ist schwerlich zu bekehren«, wenn es um Frauen und Liebe geht und die Fesseln, die durch den heiligen Bund der Ehe entstehen. Vermutlich weil er weiß, dass er nie genug Geld mit nach Hause bringen wird, um die Anvertraute glücklich zu machen. Von diesem Mangel stammt der Ausdruck ab. Mit einer Hag – das kann eine Hecke oder ein niedriger Zaun sein – umgibt man im schwäbischen Sprachraum sein Gütle. Die Silbe »stolz« leitet sich von einem germanischen Wort für »besitzen« ab. Er hat also wenig irdische Besitztümer, der Hagestolz. Ein sumpfiges Wieslein vielleicht, ein Stückchen Wald mit toten Hölzern. Damit lässt sich keine Familie ernähren, darum bleibt er, was er ist: ein Junggeselle. Später verschob sich die Begrifflichkeit und bezeichnete Männer, die zwar nicht mittellos waren, aber am liebsten bei Mama wohnen blieben. So einer war Monis neue Liebe. Ihre Beziehung war ein gordischer Liebesknoten, die so alt sind wie die Menschheit selbst, und er verdüsterte Monis Gemüt. Sie bat den »Lieben Gott« um Beistand, doch der hatte anderes zu tun. So entschied sie, Georg und Julius zurückzulassen, ließ sich von Felix scheiden, doch sie litt von nun an unter ihrer Entscheidung bis zum Ende ihrer Tage. Beide Söhne fielen im Zweiten Weltkrieg, was Moni als Strafe Gottes interpretierte.
Den Hagestolz eiste sie von der Mutter los und lebte mit ihm zusammen, bis er Anfang der 1950er-Jahre starb und sie arm wie eine Kirchenmaus zurückließ. Zum Glück besaß Moni eine weit entfernte Tante, die ein Haus in Cannstatt hatte, Kreuznacher Straße, nahe dem Kurpark. Dort kam sie unter. Lange Jahre teilte sie sich eine Wohnung mit einer Frau namens Laschinski, zu deren Aufgabe es wurde, Uroma die Neuigkeiten aus der Welt zuzutragen. Irgendwann überschrieb die Tante Moni das Haus, wo sie nun saß und an ihre verstorbenen Söhne dachte. Vor allem an Georg. Der war als Kind zum kleinen Revoluzzer geworden, weshalb Felix ihn ins Internat steckte. Das sollte der Gesellschaft draußen evangelische Pfarrer liefern, daher bläute man Georg an diesem Ort Griechisch und Latein ein. Als es ihm nach dem Schulabschluss nicht einmal im Traum einfiel, Pfarrer zu werden, forderte das Internat sämtliche Ausbildungs- und Lebenskosten zurück. Die Drohung sollte ihn gefügig machen, doch das Gegenteil war der Fall, denn mein Opa, den ich selbst leider nie kennenlernen durfte, zeigte die Art von Dickköpfigkeit, die in unserer Familie immer dann auftritt, wenn wir von der Richtigkeit unseres Tuns überzeugt sind. Georg hatte sich die Juristerei in den Kopf gesetzt, und wie man ihn beschrieben hat, wäre er sicher ein hervorragender Anwalt geworden. Doch es kam der Zweite Weltkrieg, und der verheizte ein weiteres hoffnungsvolles Leben.
Für Moni war klar, dass Gott ihren Ehebruch bestrafte. An so etwas zerbrechen die einen, andere wachsen daran. Uroma tat beides: Über den Tod der Söhne kam sie zwar nie hinweg, gleichzeitig bewahrte sie sich aber ihre aufrechte Haltung. Stets ließ sie Worten Taten folgen, was mir manches gruselige Erlebnis bescherte. Dazu gehörte ihre panische Angst vor...