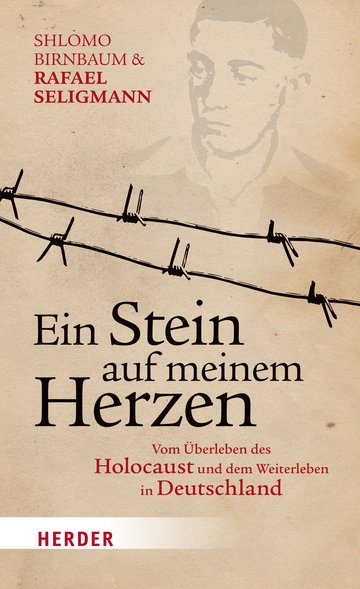Kindheit
Großvater legt seine Hand auf meine Schulter. Er redet leise, nie hebt er seine Stimme. Auch nicht, als er mit meinem Melamed, meinem Lehrer, spricht. Aber Großvater redet so, dass der Moreh nicht anders kann, als ihm zu folgen: »Du wirst das Kind nie wieder schlagen!«
Ich bin fünf Jahre alt. Seit zwei Jahren lerne ich – ungern – im Cheder, der Lernstube. Auf dem Weg dorthin trödele ich, spiele mit allem, was mir auf der Straße begegnet. Oft passiert auch Unliebsames. Polnische Nachbarjungen haben es wieder einmal auf mich abgesehen. Den kleinen Jid, wie sie mich nennen. Pünktlich und ohne Schläge zum Unterricht komme ich nur, wenn Vater oder Großvater mich auf unserem Fuhrwerk mitnehmen und direkt am Cheder abliefern.
An der Tür angekommen, stelle ich mich auf die Zehenspitzen, ergreife die schwere Klinke, ziehe sie herunter und öffne die Pforte. Drinnen riecht es nach Feuchtigkeit, alten Büchern, Kindern und unserem Melamed. Zwölf Buben unterrichtet er. Es gibt noch kleinere als mich, doch die meisten sind ein paar Jahre älter. Wir sind um einen schweren Holztisch platziert. Die Jüngsten von uns reichen mit dem Kopf gerade über die Platte. Die ist übersät mit zerfledderten Büchern. Der Melamed unserer kleinen Religionsschule hat einen langen dunklen Bart und trägt ein weißes Hemd, darüber eine schwarze, fadenscheinige Weste. Auf seinem Haupt hat er eine schwarze Kippa. Meist steht er oben am Tischende. Doch wenn er sich veranlasst sieht, um den Tisch herumzugehen, zieht man besser den Kopf ein.
Der Melamed soll ein kluger Mann sein. Vater behauptet, er habe den Verstand eines Rabbis. Warum steht er dann nicht in der Synagoge vorne in prächtigen Kleidern, statt uns im Cheder zu plagen? Unser Melamed trägt den Namen eines Propheten: Ezechiel. Jiddisch: Chaskel. Er hat sein ganzes Leben dem Studium der Thora, des Talmud, gewidmet. Es gibt viele, viele gelehrte, fromme Männer wie unseren Moreh im Polen meiner Kindheit. Sie haben ihre von Jahr zu Jahr um ein Kind größer werdenden Familien zu ernähren. Ich weiß, dass der Melamed auf das Geld, das er für den Unterricht von uns Jungen im Cheder bekommt, angewiesen ist. Damit muss er auskommen. Und damit, was ihm seine Eltern und Schwiegereltern vielleicht zustecken.
Der Cheder ist eng, mein Sitznachbar schwitzt, und auch mir ist warm. Staubflocken tanzen im Sonnenlicht, das von draußen durch die ungewaschenen Scheiben fällt. Die Kleinsten pauken das hebräische Alphabet. Laut sagen sie mit ihren Stimmchen her: Alef, Alef, Beth, Beth, Gimmel … Immer wieder. Bis es in den kleinen Köpfen fest sitzt. Wir Größeren lernen schon aus der Thora. Auswendig müssen wir die Worte beherrschen, die uns der Chumash (jiddisch »Chumesh«), die Fünf Bücher der Thora, überliefert. Ein Jude hat die Thora zu kennen, sonst ist er kein Jude, sagt unser Melamed. Parascha für Parascha, Abschnitt für Abschnitt, wiederholen wir so lange, bis wir uns die Worte für immer gemerkt haben. Auswendiglernen schult das Gedächtnis für das ganze Leben. Darum nennt man den Cheder, ja selbst die Synagoge, Schul’. Oft deklamieren wir auch die Texte in dem aus undenklichen Zeiten herrührenden Singsang. Das hilft, uns den Stoff besonders gut einzuprägen. Wir lernen Gebete und Brachot, die Segenssprüche. Hier und zu Hause werden wir von Kindesbeinen mit den 613 Gesetzen vertraut gemacht, die das Dasein der gläubigen Juden ausmachen.
Aber das Leben, das mich beschäftigt, muss mir nicht eingetrichtert werden. Es ist draußen, im Freien. Auf dem Fensterbrett haben sich zwei Tauben niedergelassen. Sie rucken mit den Hälsen und glätten ihr Gefieder in der Sonne. Ich höre ihr Gurren durch die Scheiben. Ich habe Tauben gern. Am liebsten hätte ich zu Hause einen Schlag, in dem ich sie halten kann. Ich habe beobachtet, wie ein Händler die Vögel auf der Straße verkauft. Ich würde sie fliegen lassen. Hoch im Himmel würden sie frei ihre Kreise ziehen und dann zu mir zurückkehren …
Eine Kopfnuss des Melamed reißt mich aus meinen Fantasien. Er hat mich zum Hersagen aufgerufen. Aber ich habe ihn nicht gehört und den Text gerade vergessen.
»Shlojme?!«, droht der Lehrer. »Was haben wir heute gelernt?«
Ich bringe kein Wort heraus. Die anderen Kinder gucken zu mir herüber. Neugierig. Und schadenfroh. Ich zucke mit der Schulter. Senke meinen Blick. Ich weiß, was jetzt kommt.
»Hände!«
Das Holzlineal saust auf meine Finger nieder. Einmal, zweimal, immer wieder. Der Schmerz treibt mir die Tränen in die Augen. Als der Lehrer endlich aufhört, springe ich auf und laufe aus der Stube. Sie sollen nicht sehen, dass ich weine.
Zu Hause zieht Großvater ein Taschentuch hervor, trocknet meine Tränen und heißt mich, meine Nase zu putzen. Was ist geschehen? Ich berichte ihm von den Schlägen mit dem Lineal. »Die Tauben haben so laut gerufen, dass ich aus dem Fenster gucken musste. Aber nur kurz …« Großvater lächelt. Ich erzähle ihm, dass der Melamed uns an den Ohren reißt, wenn wir nicht aufmerksam sind, Backpfeifen verteilt, wenn wir nicht sogleich alles richtig hersagen. Ich verkünde auch, dass ich nie mehr in den Cheder gehen werde. Großvater hört meinem Klagen wortlos zu. Dann steht er auf, nimmt mich bei der Hand. Zusammen gehen wir den Weg hinunter zur Lernstube. Bei Großvater gibt es kein »Ich will nicht.« Alle folgen ihm. Selbst mein Tate, mein Vater, und sein Schwiegersohn.
»Chaskel! Du wirst bezahlt, die Kinder zu lehren«, sagt Großvater zum Melamed. »Nicht, um sie mit deinen Händen zu strafen!« Er sieht den Lehrer fest an: »Allein Vater und Mutter wissen, wann ein Kind zu strafen ist und wie – nicht du!« Es ist ganz still im Raum, der sonst von Kinderstimmen erfüllt ist. So etwas hat hier noch niemand gehört. Großvater dreht sich um: »Komm, Shlojme!« Zusammen verlassen wir den Cheder und gehen nach Hause.
Meine Familie und ich wohnen in der ulica Warszawska Nummer 164. Unsere Straße führt von Tschenstochau in die Hauptstadt Polens. An unserem Haus verrinnt die Stadt. Sie geht ins Land über. Um uns herum erstrecken sich Felder und Weiden. Wir sind nicht arm, wir sind nicht reich. Wir haben genug zu essen, besonders gut am Schabbat, und das Dach über dem Kopf gehört uns. Am wichtigsten ist, dass man Gottes Gebote befolgt und zufrieden ist, sagt mein Tate. Und rezitiert in der Tonlage unseres Melameds seinen Lieblingssatz aus den Pirkei Avot, den Sprüchen der Väter: »Wer ist reich? Der mit seinem Los zufrieden ist.«
Helen und Shlomo Birnbaum im Kreise ihrer Kinder und Enkel
Unser Heim ist ein flaches Gebäude. Großvater hat es selbst gebaut. Ein Haus mit mehreren Wohnungen. Wir bewohnen einen Teil davon, die anderen Räume sind vermietet. Im Hof befindet sich ein Stall für die Pferde und Kühe, die mein Vater hält, und eine Scheune, in der er Getreide lagern kann. Davor steht ein großer Ahornbaum. Vater handelt mit Hafer, Stroh und Kleie für das Vieh. Zudem bringt er Weizen und Roggen in eine nahe gelegene Mühle, holt das gemahlene Mehl wieder ab und beliefert die Bäckereien in unserer Gegend damit. In der Synagoge, bei Nachbarn und Geschäftspartnern wird Vater geachtet und ist beliebt.
Seine Eltern haben ihn Arie genannt. Das passt. Er ist stark wie ein Löwe. Mein Tate stemmt Säcke, die bis zu zwei Zentner wiegen, auf seine Knie, hebt sie hoch und wirft sie ohne Anstrengung auf den Fuhrkarren. Vater lädt die Säcke und Strohballen auf, springt mit einem Satz auf den Kutschbock, schwingt die Peitsche in die Luft, ruft »Hüja!« und die Pferde traben los. Das ist eine meiner frühesten Erinnerungen.
Manchmal erfüllt Tate meinen sehnsüchtigen Wunsch und nimmt mich auf seinen Fahrten mit. Leider erst nach dem Cheder. Einmal, es wird schon dämmrig, machen wir Rast auf einem Feld. Vater sagt: »Halt die Pferde. Ich mach ein Schläfchen!« Ich sitze stolz auf dem Kutschbock, habe die Zügel fest um meine Hände geschlungen. Die Pferde stehen geduldig. Vater hat sich neben dem Wagen ausgestreckt. Da schleicht ein Mann heran. In der rechten Hand hat er ein Messer. Er will auf Vater einstechen. Ich schreie, so laut ich kann. Vater springt auf, holt aus – und der Angreifer sackt in sich zusammen. »Ein Klopp‘ und der Polack war weg«, lacht Vater am Abend, als er die Geschichte zu Hause erzählt. Vater erscheint mir unverwundbar. Ich ahne nicht, wie sehr ich bald seinen Schutz brauchen werde.
Vater ist nicht nur stark und mutig, sondern auch ein Macher. Er packt zu, ergreift jede Gelegenheit beim Schopf. »Als Geschäftsmann musst du Chancen und Risiken abwägen und dann blitzschnell entscheiden«, sagt er mir. »Nicht fragen, Shlojme, tun!« Vater ist viel unterwegs. Seine dauernde Tätigkeit, seine Umsicht, seine Gabe, sich unverzüglich auf sein Gegenüber einzustellen, ohne dabei seine eigenen Bedürfnisse zu vergessen, aber auch ein Maß gesundes Misstrauen zeichnen ihn aus. Vor allem aber besitzt Vater eiserne Nervenkraft. Diese Fähigkeiten waren unverzichtbar, um uns durch die folgende Katastrophe zu führen.
Das Leben hatte Vater früh gezwungen, erwachsen zu werden. Geboren wird er 1897 in Kamyk, einem Dorf unweit von Tschenstochau. Seine Familie lebte dort »Dor um Dor um Dor«, seit Generationen, wie mein Vater sagte. Mein Großvater Shlomo Birnbaum, nach dem gemäß jüdischer Tradition ich benannt wurde, kannte wie alle Juden am Ort keinen Zweifel an seinem Glauben. Nach dem Besuch des Cheder hatte Großvater in einer Jeschiwa, einer Religionsschule, weitergelernt, um Rabbiner zu werden. Doch mit sechzehn Jahren sollte Shlomo zum russischen Militär eingezogen werden....