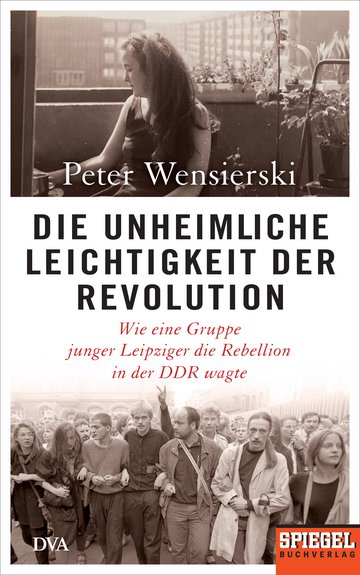Polka im Schweitzer-Haus
Frühjahr 1988
Der junge Mann auf dem Fahrrad fuhr langsam die Straße entlang, eine Hand am Lenker, in der anderen ein Buch, in dem er seelenruhig las und von dem er nur ab und zu aufschaute.
Anita blieb stehen. Statt die Straße zu überqueren, sah sie ihm von der Bordsteinkante aus nach. Das Ampelmännchen zeigte schon längst grün für sie. Er war einfach bei Rot über die Kreuzung gefahren.
Da ertönte die Sirene eines Funkstreifenwagens. Der langgezogene Jaulton war laut und nah. Der Radfahrer begriff sofort, klappte sein Buch zu und trat in die Pedale.
Der Lada der Leipziger Volkspolizei näherte sich bedrohlich schnell. Der Radler strengte sich an, dabei musste er auch noch Schlaglöchern und den Schienen der Straßenbahn ausweichen. Anita fand, das Ende der kurzen Flucht war abzusehen.
Allerdings gab es da noch diese kleine Seitenstraße, Durchfahrt verboten, Einbahnstraße. Mit einem rasanten Schwenk bog der Flüchtende im letzten Moment dort ein. Zum Erstaunen Anitas wagten es die beiden Volkspolizisten nicht, ihm entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung zu folgen. Sie stoppten ihren Wagen, schalteten das Signalhorn ab und schauten ihm nur noch hinterher. Anita setzte ihren Weg fort, aber der Kerl auf dem Rad ging ihr weiter durch den Kopf. Den will ich kennenlernen, dachte sie.
Anita wollte an diesem Morgen ihre Freundin Gesine besuchen, doch die war nicht da. Sie setzte sich ins Treppenhaus, steckte sich eine Zigarette an und wartete eine Weile. Es war still im Haus, im Hintergrund war nur ab und zu das Quietschen einer Straßenbahn zu hören.
Ihre Freundin erschien nicht. Sie hatte vor, Gesine zu einer gemeinsamen Tramptour im nächsten Sommer zu überreden. Im vergangenen Jahr war Anita alleine unterwegs gewesen, das hatte ihr nicht gefallen. Kein Solo-, aber auch kein Meutenurlaub mehr, hatte sie sich in Budapest geschworen. Sie saß da und träumte davon, gemeinsam mit ihrer besten Freundin durch die Lande zu ziehen.
Nach der dritten Alten Juwel* gab sie das Warten auf, machte sich auf den Rückweg durch die Stadt und beschloss, zum Täubchenweg zu gehen. Dort lag das Albert-Schweitzer-Haus, ein Pflegeheim, in dem sie lange Zeit gearbeitet hatte. Sie könnte dort endlich ein paar liegen gebliebene Sachen abholen.
Es war ein weiter Fußweg, aber die niedrig stehende Frühjahrssonne schien hell und wärmte schon. Ihr gleißendes Licht warf schwarze Schatten und gab den Häusern in den Straßen der Stadt klare und scharfe Konturen. Anita lief auf ihrem Weg durch den Leipziger Osten an verfallenen Gebäuden vorbei, schaute aber kaum noch hin, denn so war es schon seit Jahren, auch in anderen Teilen der Stadt. Ganze Häuserzeilen waren unbewohnt, die Fensterscheiben eingeworfen, der Bürgersteig gesperrt oder mit Brettergerüsten gegen herunterfallende Mauerteile und Dachziegel geschützt. Immer wieder große Brachen, Reste von Kellern, über denen einmal Häuser gestanden hatten, Trümmer von abgerissenen Gebäuden, vor kurzem erst zusammengeschobene Haufen, aus denen schwarze Holzbalken in die Luft ragten.
Im Täubchenweg stand Anita schließlich vor ihrer alten Arbeitsstelle. Das kirchliche Pflegeheim war ein mehrstöckiger, recht gut erhaltener Bau. Im Hof lag ein Kindergarten, daneben eine Polizeistation. Altersheime der Kirche hatten zwar einen besseren Ruf als staatliche Einrichtungen, doch selbst hier waren die Menschen in Zimmern mit bis zu 15 Betten untergebracht. Für persönliche Dinge und so etwas wie Privatsphäre war da kaum Platz. Jeder der Bewohner besaß nur noch das Bett und einen kleinen Nachttisch.
Anita betrat das Gebäude. Es roch muffig. Sie hielt kurz inne. War das etwa Musik? Sie ging weiter, eine Treppe hoch. Die Musik wurde lauter. Auf der obersten Stufe angekommen, konnte sie bis zum Ende des Ganges schauen. Zwischen Schlafsaaltür und Flur drehte sich ein junger Pfleger mit weißer Hose und Jacke schwungvoll zu Polkamusik mit einer der alten Frauen. Die grauhaarige Dame kicherte und gluckste vor Vergnügen. Ihr weißes, dünnes Nachthemd wehte weit um sie herum.
Anita lächelte. Sie erinnerte sich an die Momente von Freude, die es auch während ihrer Arbeit hier immer wieder gegeben hatte. Dann stutze sie. Moment mal, dachte sie, das ist doch … Es war der Radfahrer, den sie am Morgen auf der Flucht vor der Volkspolizei gesehen hatte.
Wenig später saßen sie zusammen im karg eingerichteten Pausenraum mit der Polstergarnitur aus braunem Cord, vergilbten Vorhängen am Fenster und einer leeren Schrankwand. Sie tauschten sich über ihre Erlebnisse bei der Arbeit im Albert-Schweitzer-Haus aus. Uwe erzählte von der alten Frau Reiter, die immer nur dieselbe Zeitung mit Bildern von Blumen und anderen Pflanzen las. »Wenn ich neben dem Bett der 93-Jährigen stand, zeigte sie mit dem Finger auf ein Bild und sagte: ›Die will ich kaufen, wenn ich wieder einen Garten hab!‹«
Obwohl es traurig war, mussten beide lachen.
Uwe erzählte Anita von Frau Süß, der er jeden Abend ein Gutenachtküsschen geben musste, von Frau Meier, zu der er sagte, komm, wir gehen jetzt ins Bett, und sie antwortete, das habe ich noch nie mit einem fremden Mann gemacht, von Margot, der Behinderten, die mehrere Gebisse vertauschte, so dass die Frauen im Saal alle Gebisse durchprobieren mussten, bis jede wieder ihr eigenes hatte. Uwe, der mit seinen 25 Jahren kaum noch Haare auf dem Kopf trug, schilderte, wie fröhlich und eitel es im Saal beim Haareschneiden zugehen konnte, dabei verpasste er doch den Frauen meist nur einen »Rupper«, einen Kurzhaarschnitt mit dem Rasierer.
Er wurde ernst, als Anita von einer Frau berichtete, die sie immer vorsichtig gefüttert hatte, weil sie nicht mehr richtig schlucken konnte.
»Als ich freihatte, ist sie erstickt.«
Anita hatte oft ganz allein Nachtwache gehabt, und es war für sie schwer zu ertragen gewesen, wenn jemand im Sterben lag in einem Zimmer mit fünfzehn anderen.
Das hatte Uwe auch schon öfter miterlebt. »Ich muss hier manchmal einfach Blödsinn machen«, sagte er, »sonst kann man das alles gar nicht aushalten.«
Während er weiterredete, sah ihn Anita lange an. Es hatte etwas Warmherziges, wie er über die alten Frauen hier sprach. Das gefiel ihr. Da hatte jemand Freude am Leben und war an Menschen interessiert. Der allgegenwärtige Frust machte ihm offenbar nicht viel aus.
»Habt ihr damals auch, wenn es keine Windeln gab, im Keller selbst welche aus Zellstoff und Baumwolltüchern zusammengelegt?«, wollte Uwe wissen.
Anita nickte: »Na klar, immer wieder. Wir haben viel improvisiert, darin waren wir ziemlich gut. Trotz allem hab ich hier sehr gern gearbeitet.« Besonders gut gefallen hatte ihr, dass die meisten Alten so lebendige Geschichten aus der Zeit des Weltkriegs, aus den Aufbaujahren und vom Mauerbau erzählen konnten. »Ich habe viel über Leipzig erfahren.« Anita hatte das Schweitzer-Haus verlassen und bei der Kirche eine Ausbildung als Sozialarbeiterin begonnen.
Was ihm immer wehtue, sagte Uwe, seien die Kurzbesuche von Verwandten, die nur kämen, um die Renten der bettlägerigen Frauen abzuholen.
Nach einer Weile erschien Uwes Freund Frank, der in einer anderen Abteilung arbeitete. Er ließ sich mit einem Seufzer auf das Cordsofa fallen. Im Erdgeschoss hatten Kinder aus dem Kindergarten zur Unterhaltung der Alten gesungen. Frank musste deshalb einige seiner Frauen drei Stockwerke erst hinunter- und danach wieder hinauftragen. Einen Lift gab es nicht. Er war geschafft.
Uwe fragte ihn, ob Anke das Vorsingen organisiert habe. Er wusste, Frank interessierte sich für Anke. Sie war mit zwanzig Jahren eine der jüngsten und hübschesten Mitarbeiterinnen des Kindergartens im Hof. Anke hatte erst gestern mit Uwe und Frank zusammengesessen und von ihrem Elternabend berichtet, den sie zum Thema »Umweltschutz mit Kindern« veranstaltet hatte.
Ja, sie sei dabei gewesen, beantwortete Frank Uwes Frage. Aber im Moment war er mehr interessiert an der Frau in der flattrigen Hippiekleidung, die er nicht kannte. Als er erfuhr, dass Anita hier früher einmal gearbeitet hatte, kam Frank schnell auf das Regiment zu sprechen, das die alten Diakonissen im Hause führten.
»Für die sind doch Leute wie wir exotisch.«
Anita gab ihm recht. Frank und Uwe waren eher zufällig in dem christlichen Pflegeheim gelandet, weil sie irgendeinen Job brauchten, der sie vor Ärger mit den Behörden schützte. Solcher Ärger war unausweichlich für Jugendliche, die wie sie keine Chance auf eine übliche Berufskarriere hatten, nachdem ihnen bereits als Schülern das Abitur und erst recht ein Studium verwehrt worden war. Wer jedoch nicht arbeitete und damit nicht am Aufbau des Sozialismus teilnahm, konnte wegen asozialen Verhaltens* belangt werden. Viele Gleichaltrige landeten deswegen in Jugendwerkhöfen*.
»Wisst ihr, wie ich hier ins Schweitzer-Haus gekommen bin?«, fragte Uwe. »Ich bin beim Friedensgebet in der Nikolaikirche nach vorn gegangen und habe in meiner Fürbitte einen zivilen Ersatzdienst gefordert. Danach sprach mich eine Diakonisse an und meinte: ›Wieso reden Sie eigentlich immer nur davon? Sie könnten doch jetzt schon aktiv werden und bei uns im Pflegeheim arbeiten. Wir suchen junge kräftige Männer.‹ Sie gab mir eine Telefonnummer, ich rief an, ging hin, und seitdem arbeite ich hier.«
Frank meinte, ihm gehe das fromme Getue auf den Wecker. Immer wieder hätten sie Diskussionen mit den Diakonissen, die ihren Widerstandsgeist nicht verstünden.
»Sie finden sich damit ab, dass alles von Gott vorbestimmt sei, und hoffen darauf, dass er irgendwann ihre Gebete...