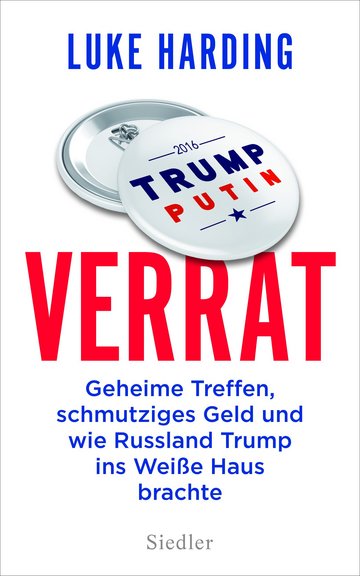Prolog
Ein Treffen
Dezember 2016
Grosvenor Gardens, London SW1
Victoria Station in London. Eine Mischung aus heruntergekommen und elegant. Hier befinden sich ein großer Bahnhof, ein Busterminal und – etwas weiter – ein dreieckiger Park mit einem Reiterstandbild des französischen Marschalls Foch, eines Helden des Ersten Weltkriegs. Auf seinem Sockel steht: »Ich weiß, dass ich England gedient habe.« Mit einem schwarzen Stift hat jemand hinzugefügt: »indem ich Tausende ermordete«.
Hier herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Um die Statue herum stehen braune Bänke, bespritzt mit weißem Taubenkot, und hohe Platanen. Man sieht Touristen, Pendler und den kauzigen, haarigen Penner, der an einer Dose Lagerbier nippt und vor sich hin murmelt. Der Mann, dem dieses Grundstück in bester Lage gehört, ist der Duke of Westminster. Er ist der reichste Adlige Großbritanniens.
Wenn man geradeaus weitergeht, gelangt man zu einer Reihe hoher neoklassizistischer Häuser im französischen Renaissancestil. Dies ist Grosvenor Gardens. Die Straße führt zur rückwärtigen Mauer einer weltberühmten Residenz, des Buckingham Palace. Mit etwas Schneid und einer langen Leiter könnte man sich vielleicht direkt in den Privatgarten Ihrer Majestät schwingen. Seine Tannen, die in den grauen Londoner Himmel aufragen, kann der einfache Bürger sehen. Der Queen’s Lake dagegen entzieht sich seinem Blick.
Einige der Häuser hier verraten, wen sie beherbergen: eine PR-Firma, ein japanisches Restaurant, eine Sprachschule. Aber an dem Gebäude Grosvenor Gardens Nr. 9-11 findet sich keinerlei Hinweis darauf, wer oder was im Innern ist. Zwei Säulen rahmen eine anonyme schwarze Eingangstür. Ein Videoüberwachung-Hinweisschild warnt den Besucher. Keine Namen an der Türklingel. Darüber drei Stockwerke mit Büroräumen.
Wenn man eintritt und nach rechts geht, gelangt man in eine bescheidene Parterre-Suite, eine Reihe schmuckloser, elfenbeinweiß gestrichener Räume. Eine mittelgroße, farbige Weltkarte schmückt eine Wand. Da stehen Computer, und an den hohen Fenstern hängen weiße Jalousien. Auch Zeitungen sind da: ein Exemplar der Londoner Times. Man wähnt sich in den Räumen eines kleinen, diskreten Beratungsunternehmens.
Und damit liegt man nicht falsch, denn hier hat die britische Firma Orbis Business Intelligence Limited ihren Sitz. Auf der Orbis-Website steht: »ein führendes Beratungsunternehmen im Bereich Corporate Intelligence« (Informationsbeschaffung über Unternehmen). Und weiter, etwas schwammig: »Wir stellen hochrangigen Entscheidungsträgern strategische Erkenntnisse, Informationen und investigative Dienstleistungen zur Verfügung. Wir arbeiten dann mit unseren Klienten an der Umsetzung von Strategien, die ihre weltweiten Interessen schützen.«
Im Klartext: Orbis ist im nichtstaatlichen Spionagegeschäft tätig. Das Unternehmen betreibt Spionage für gewerbliche Kunden – es forscht die Geheimnisse von Privatpersonen und Institutionen, Regierungen und internationalen Organisationen aus. London ist die Welthauptstadt dieses Sektors der privaten Informationsbeschaffung. Eine knallharte Branche, in den Worten eines ehemaligen britischen Geheimdienstlers, der sich hier verdingte, ehe er einen Job bei einem großen Unternehmen ergatterte. Es gibt mehr als ein Dutzend dieser Firmen, in denen hauptsächlich ehemalige Nachrichtendienstler arbeiten, die sich auf Nachrichtengewinnung im Ausland spezialisiert haben.
Das ist nicht die Welt der klassischen Spionage oder von James Bond. Aber es ist nicht weit davon entfernt.
Der Chef von Orbis heißt Christopher Steele. Steele und sein Geschäftspartner Christopher Burrows sind die Direktoren von Orbis. Beide sind Briten. Steele ist 52, Burrows etwas älter, 58. Ihre Namen tauchen in dem öffentlichen Informationsmaterial von Orbis nicht auf. Auch ihre früheren Berufswege werden nicht erwähnt. Zwei smarte Hochschulabsolventen arbeiten mit ihnen zusammen. Sie bilden ein kleines Team.
Steeles Büro liefert nur wenige Anhaltspunkte, was die Art dieser verdeckten Aktionen anlangt.
Eigentlich gibt es nur einen Hinweis.
In der Nähe des Schreibtischs sind russische Puppen – Matrjoschkas – aufgereiht. Ein Souvenir aus Moskau. Sie stellen die großen russischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts dar: Tolstoi, Gogol, Lermontow und Puschkin. Die Puppen sind von Hand bemalt, und die Namen der Schriftsteller stehen in blumigen kyrillischen Buchstaben knapp oberhalb ihres Fußes. Der Großbuchstabe T von Tolstoi ähnelt einem verschnörkelten griechischen Pi.
In den turbulenten Tagen des Jahres 2016 waren die Puppen eine ausgezeichnete Metapher für die erstaunlichen geheimen Nachforschungen, mit denen Steele gerade beauftragt worden war. Es war ein brisanter Auftrag – die innersten Geheimnisse der Beziehungen des Kreml zu einem gewissen Donald J. Trump aufzudecken, sie zu entschachteln wie diese Puppen, bis die Wahrheit schließlich ans Tageslicht käme. Seine Schlussfolgerungen sollten die US-amerikanischen Nachrichtendienste erschüttern und ein politisches Erdbeben auslösen, wie man es seit den dunklen Tagen des Watergate-Skandals während der Amtszeit von Präsident Nixon nicht mehr erlebt hatte.
Die Ergebnisse der Nachforschungen Steeles waren sensationell, und das darauf basierende Dossier sollte den gewählten Präsidenten Trump des schlimmsten Verbrechens bezichtigen: verbotener geheimer Absprachen mit einer ausländischen Regierung. Diese ausländische Regierung ist die russische. Das mutmaßliche Verbrechen – das entschieden geleugnet und bestritten und in manchen zentralen Punkten wohl nicht zu beweisen sein wird – ist Hochverrat. Der designierte neue US-Präsident sei, so wurde gemunkelt, ein Verräter.
Einer derart unglaublichen Verschwörung begegnet man sonst nur in Romanen: In dem Thriller Botschafter der Angst (The Manchurian Candidate) schildert der Autor Richard Condon ein sowjetisch-chinesisches Komplott mit dem Ziel, die Kontrolle über das Weiße Haus zu erlangen. Oder in einem weitgehend in Vergessenheit geratenen Politthriller des Schriftstellers Ted Allbeury, In der Hand des Kreml (The Twentieth Day of January). Darin wirbt Moskau während der Pariser Studentenunruhen im Jahr 1968 einen jungen Amerikaner an, der sich nunmehr Höherem zuwendet. Wie Steele war auch Allbeury ein ehemaliger britischer Geheimdienstler.
Bevor sein Dossier so hohe Wellen in der Öffentlichkeit schlug, war Steele unbekannt. Unbekannt jedenfalls außerhalb eines engen Kreises von US-amerikanischen und britischen Geheimdienst-Insidern und Russland-Experten. Das war ihm lieber so.
Das Jahr 2016 war eine historische Zäsur. Zuerst kam der Schock des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union. Dann wurde zur Überraschung vieler Amerikaner und zum Entsetzen nicht weniger von ihnen, ganz zu schweigen von vielen anderen Menschen weltweit, Donald J. Trump in diesem November zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt.
Der Wahlkampf, der ihn ins Weiße Haus brachte, war erbittert, polarisierend und bösartig gewesen. Überschattet wurde die Wahl von einem beispiellosen und schier ungeheuerlichen Verdacht: Eine ausländische Regierung, die traditionell als Feind der USA galt, habe Trump insgeheim in seiner Kampagne, die eigentlich aussichtslos schien, unterstützt und ihn damit vielleicht sogar über die Ziellinie geschubst. Der Verdacht lautete, dass Trump der Kandidat des Kreml war.
Trump sei eine Marionette Putins, eines Menschen also, den führende Republikaner bislang als einen eiskalten KGB-Schurken betrachtet hatten. John McCain, der republikanische Senator aus Arizona, brachte diese Einschätzung auf den Punkt, als er Putin einen »Gangster und Mörder« nannte. Jemand, der Amerika übelwollte.
Zu diesem Zeitpunkt war der Verdacht geheimer Absprachen mit Moskau aus zwei Gründen an Trump hängen geblieben. Zum einen war da Trumps eigenes seltsames Verhalten im Wahlkampf. Angesichts von Behauptungen, Russland hacke E-Mails der Demokratischen Partei und gebe sie ins Publikum, um Hillary Clinton zu schaden, forderte ihr Rivale, Donald Trump, Moskau öffentlich auf, damit fortzufahren.
Auf einer Pressekonferenz im Juli 2016 in Florida sagte er: »Russland, falls du gerade zuhören solltest: Ich hoffe, du kannst die 30 000 verschwundenen E-Mails finden. Wahrscheinlich wird dich unsere Presse dafür großzügig belohnen. Mal sehen, ob das passiert.«
Ein Clinton-Berater wies darauf hin, dass dies eine direkte Aufforderung an eine ausländische Macht gewesen sei, Spionage gegen einen politischen Gegner zu betreiben. War das Trumps Opportunismus? Oder war es doch eher ein wohlkoordinierter, finsterer Plan?
Kaum jemand bezweifelte, dass die im Juni und Oktober 2016 auf WikiLeaks veröffentlichten E-Mails der Kandidatin der Demokraten schadeten. An sich waren sie nicht besonders skandalös. Doch für einen skrupellosen Gegner wie Trump waren sie ein Geschenk, ein großartiges Geschenk: eine Gelegenheit, sich die Medienmaschinerie zunutze zu machen und die Botschaft von »Crooked Hillary« (der betrügerischen Hillary) zu verbreiten. Moskau hatte auch E-Mails des Republican National Committee (Organisationsgremiums der Republikanischen Partei) gehackt, diese aber nicht veröffentlicht.
Der zweite Grund: Wie ließ sich Trumps schmeichelhaftes Lob Putins erklären? In der aufgeheizten Stimmung, die in den Monaten vor der Wahl am...