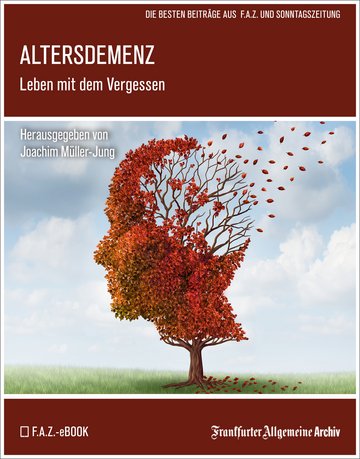Eingreifen, bevor es zu spät ist
Alzheimer macht sich erst bemerkbar, wenn das Gehirn schon stark geschädigt ist. Umso wichtiger wäre die Früherkennung. Hier gibt es Fortschritte. Aber noch immer kein Medikament.
Von Michael Brendler
Wer in den vergangenen Jahren zur AAIC, der Jahreskonferenz der Internationalen Alzheimer Gesellschaft, reiste, kam in der Regel mit schlechten Nachrichten zurück. »Als Alzheimer-Forscher hat man gelernt, demütig zu sein«, sagt Oliver Peters, Leiter der Altersmedizin an der Berliner Charité. Impfung, Antikörper, Enzymhemmstoffe – bisher hat sich noch jeder Versuch, den Patienten wirklich weiterzuhelfen, als Fehlschlag entpuppt.
Geradezu depressiv war die Stimmung 2013, nachdem der letzte große Hoffnungsträger, der Wirkstoff Solanezumab, abgestürzt war. Daran erinnert sich Frank Jessen, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsklinik Köln, der sich nun drei Jahre später wieder zum Branchentreffen nach Amerika aufmachte. Aber dieses Mal sei alles anders gewesen, berichtet er: Hoffnungsvolle Aufbruchsstimmung habe in Washington geherrscht. Dafür sorgt nun ausgerechnet der bereits abgeschriebene Hoffnungsträger Solanezumab.
Der Pharmakonzern Lilly, der diesen Antikörper entwickelt hatte, ließ die klinische Studie trotz ernüchternder Resultate weiterführen. Allerdings konzentrierte man sich dabei auf Patienten, bei denen die Krankheit gerade erst in Erscheinung getreten war. Und an ihnen beobachtete man unter Hinzuziehung der Statistik tatsächlich einen gewissen Effekt. Wie zuverlässig diese Ergebnisse sind, lässt sich noch nicht sagen, weil es keine Vergleichsgruppe gab, der stattdessen nur ein Placebomedikament verabreicht worden wäre. »Das ist sicher noch kein Durchbruch«, sagt Oliver Peters. Die jüngsten Erfolgsmeldungen seien »mit Vorsicht zu genießen«. Was in diesem Antikörper steckt, der sich gegen die sogenannten Beta-Amyloide richtet, werde erst die umfassendere Zulassungsstudie zeigen. Deren Ergebnisse sind nicht vor 2017 zu erwarten.
Aber selbst dieser kleine Hoffnungsschimmer beflügelt die Zunft der Alzheimer-Forscher. Einig sind sich die meisten inzwischen darin, dass eine Therapie, um überhaupt Erfolg zu haben, möglichst vor dem Ausbruch der Demenz beginnen sollte. Bisher bestand das Dilemma darin, dass man keine Ahnung hatte, wie man die drohende Gefahr angesichts noch nicht vorhandener Symptome rechtzeitig erkennen könnte. Das ist nun die zweite gute Nachricht von der Washingtoner Konferenz: Neue Verfahren scheinen das möglich zu machen.
Der Uhrentest nach Shulman wird auch bei der Diagnostik von Demenz eingesetzt. Mithilfe des Tests lassen sich Defizite in der räumlichen Vorstellungs- und Darstellungskraft sowie der Fähigkeit des Problemlösens erkennen.
Illustration: www.vitanet.de / © vitapublic GmbH
Bisher wird vor allem mit Hilfe neuropsychologischer Tests geprüft, ob sich hinter ersten Gedächtnisschwächen, die meist im späten Rentenalter auftreten, ein Morbus Alzheimer verbergen könnte. Durch den sogenannten Uhrentest, wie oben abgebildet, wird beispielsweise überprüft, ob jemand noch komplexe Muster beherrscht. Durch Fragebögen wird ermittelt, wie gut er sich etwas merken kann. Doch wenn er dabei deutliche Schwächen zeigt, ist die Hirnkrankheit bereits fortgeschritten. Sie beginnt meist schleichend und wesentlich früher, wie die Neurowissenschaftlerin Courtney Lynn Sutphen von der Washington University kürzlich im Fachjournal Jama Neurology dargelegt hat. Alzheimer setzt bei vielen der Patienten unbemerkt schon Mitte 50 ein, bei manchen sogar Mitte 40. Auch Kernspintomographien sind in diesem Stadium keine Hilfe, weil sie erst größere Zerstörungen sichtbar machen können.
Die Fahndung nach Alzheimer konzentriert sich meist auf das sogenannte Beta-Amyloid. Im Gehirn eines gesunden Menschen unterstützt dieses Peptid die Nervenzellen bei der Informationsverarbeitung. Im Hirn von Alzheimer-Patienten wird jedoch zu viel davon gebildet oder zu wenig entsorgt, so dass sich das Eiweiß in und um die Nervenzellen herum ansammelt. Irgendwann ändern die Amyloide aus unbekannten Gründen ihre Struktur, falten sich um und rotten sich zusammen. Einige von ihnen lagern sich zu harmloseren Eiweißklumpen, den sogenannten Plaques zusammen. Andere bilden kleinere Gruppen und werden als Oligomere zu »aggressiven Torpedos«, wie sie Jens Wiltfang, Chef der Klinik für Psychiatrie an der Universität Göttingen, nennt. Wahrscheinlich setzen sie eine weitere Kaskade zerstörerischer Mechanismen in Gang.
Unter dem Mikroskop ließen sich Amyloide schon vor hundert Jahren im Hirnmaterial von Verstorbenen erkennen. Um die Jahrtausendwende gelang es dann, die Peptide radioaktiv zu markieren und so im Gehirn ihrer Patienten schon zu Lebzeiten mittels Positronen-Emissions-Tomographen (PET) aufzuspüren. In den Aufnahmen leuchtet es hell auf, wo sich Plaques abgelagert haben. Zeigt ein Mensch erste Symptome einer leichten Demenz, kann eine solche Amyloid-PET-Untersuchung mit achtzig- bis neunzigprozentiger Wahrscheinlichkeit voraussagen, ob bei ihm die Krankheit in den nächsten fünf Jahren vollständig ausbricht oder nicht. Jeder vierte Alzheimer-Patient ist im PET allerdings unauffällig. »Wahrscheinlich weil in diesen Fällen auch andere Entstehungsmechanismen eine Rolle spielen«, sagt Frank Jessen. Zudem sage die Untersuchung wenig über den weiteren Krankheitsverlauf aus.
Genau hier könnte ein neues Verfahren weiterhelfen, das jetzt in Washington für Diskussionen sorgte. Gemeint ist das »Tau-PET«. Anstelle des Amyloids wird dafür das sogenannte Tau-Protein markiert, das in den Nervenzellen für den intrazellulären Transport von Botenstoffen und anderen Substanzen sorgt. Bei Kranken ist das Molekül derart mit Phosphatgruppen gespickt, dass es diese Aufgabe nicht mehr erfüllen kann. Es bildet dann regelrechte Bündel, und der Transport bricht zusammen. Weil Tau später als das Amyloid in den Krankheitsprozess eingreift, soll dessen Beobachtung eigentlich etwas über das Voranschreiten aussagen. So hofft man, Patienten zu identifizieren, die besonders dringend einer Behandlung bedürfen.
Jessen überlegt nun, die Betroffenen wesentlich früher in den Tomographen zu legen. Bisher galten Personen, die ausschließlich selbst ihr Gedächtnis schwinden sahen, ohne dass die Umwelt davon etwas bemerkte, als »Worried Well«, also als »besorgte Gesunde«. Der Prominente Gunter Sachs nahm diese Selbstdiagnose sogar zum Anlass, sich das Leben zu nehmen. Ob solche Sorgen berechtigt sind, könnte man immerhin mit den PET-Verfahren herausfinden, sagt Jessen. Denn im Vergleich zu Gleichaltrigen ließen sich in den Köpfen der »Worried Well« tatsächlich häufiger Alzheimer-Ablagerungen aufstöbern. Michael Hüll, der das Zentrum für Gerontopsychiatrie in Emmendingen leitet, ist in dieser Hinsicht zögerlicher: Jahre, vielleicht Jahrzehnte könnten zwischen dem Nachweis einer Ablagerung und dem Auftreten der Demenz liegen. »Gerade bei älteren Menschen können andere Erkrankungen deren Lebenszeit begrenzen.« Angesichts der Untersuchungskosten von knapp zweitausend Euro, die von den Kassen in der Regel nicht übernommen werden, kein unerheblicher Einwand.
In Göttingen arbeitet Jens Wiltfang deshalb an einer preisgünstigen Alternative. Er will das Beta-Amyloid nicht mit teuren Tomographen aufspüren, sondern in Proben von Hirnflüssigkeit, dem Liquor, oder im Blut. Denn auch im Blut breitet sich beim Kranken das Beta-Amyloid, abgekürzt A, aus. Interessant ist in diesem Zusammenhang ist die Unterform A-42, denn insbesondere diese neigt dazu, gefährliche Torpedos zu bilden. Die Washingtoner Neurologin Sutphen fand auffällige A-42-Werte bereits im mittleren Lebensalter. In Fachkreisen ist man bereits überzeugt von diesem Verfahren: Der Forschergemeinde genügt schon die Kombination aus positivem Liquor-Amyloid-Befund und leichten kognitiven Defiziten, um die Diagnose einer präklinischen Vorstufe von Alzheimer zu stellen. Wertvoll, sagt der Psychiater Wiltfang, sei auch der Liquor-Test auf Tau-Proteine. Erhöhte Werte weisen darauf hin, dass die Zerstörung der Hirnsubstanz bereits eingesetzt hat.
Die Entnahme von Hirnflüssigkeit ist allerdings nicht ungefährlich. Sicherer und bequemer wäre ein Bluttest, wie ihn Wiltfang jetzt entwickeln will. Bisher hielt man diesen Ansatz für aussichtslos, weil die Schranke zwischen Blutbahn und Gehirn die verräterischen Substanzen zurückhält. Jetzt hat man aber entdeckt, dass nicht nur das Hirn der Alzheimer-Patienten Probleme mit dem Amyloid-Stoffwechsel zu haben scheint, sondern auch ihr gesamter Körpers. Wiltfang entdeckte in Blut- und Liquorproben nicht nur das altbekannte A, sondern noch ganz andere Peptide. Diese verkürzten oder verlängerten Amyloide hält der Mediziner für interessante Angriffsziele der Pharmaforschung. Bisher haben sie sich der Therapie weitgehend entzogen, eben weil sie im Körper an mehreren Stellen eine Schlüsselposition einnehmen. Wiltfang hat jedoch Enzyme aufgespürt, die an der Synthese dieser Stoffe beteiligt sind. Sie ließen sich vielleicht gezielter ansteuern.
Zusammen mit einer Firma arbeitet Wiltfang nun an einem marktfähigen Test, der auf diesem Prinzip beruht. Zusammen mit der Forschergruppe von Klaus Gerwert an der Universität Bochum hat er zudem ein Verfahren entwickelt, mit dem sich bestimmen lässt, in welchem Faltungszustand ein Amyloid im Blut oder im Liquor vorliegt. Entscheidend ist, ob es bereits zum Torpedo umstrukturiert ist. »Erste klinische Tests deuten darauf hin, dass wir damit Frühformen der Alzheimer-Demenz mit einer diagnostischen Genauigkeit von bis...