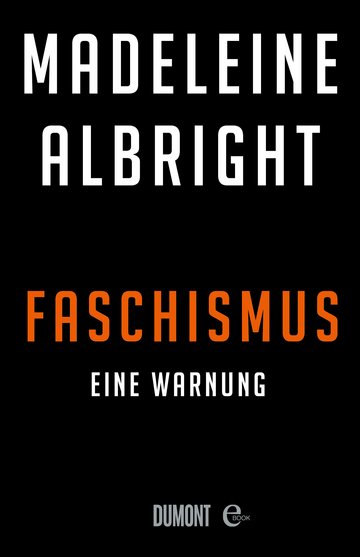1
Eine Ideologie aus Angst und Schrecken
An dem Tag, als die Faschisten zum ersten Mal in mein Leben eingriffen, hatte ich gerade erst laufen gelernt. Es war der 15. März 1939. Verbände der deutschen Wehrmacht marschierten in das Land meiner Geburt, die Tschechoslowakei, ein, eskortierten Adolf Hitler auf den Hradschin und brachten Europa an die Schwelle eines zweiten Weltkriegs. Nachdem meine Eltern sich mit mir zehn Tage lang versteckt hatten, gelang uns die Flucht nach London. Dort trafen wir auf Exilanten aus ganz Europa, die wie meine Eltern die alliierten Kriegsanstrengungen unterstützten, während wir voller Sorge auf das Ende unserer Marter warteten.
Als die Nazis nach sechs zermürbenden Jahren kapitulierten, kehrten wir hoffnungsfroh in unsere Heimat zurück und machten uns voll Eifer daran, uns ein neues Leben in einem freien Land aufzubauen. Mein Vater nahm seine Tätigkeit im tschechoslowakischen Außenministerium wieder auf, und eine Zeit lang schien alles gut. Dann, im Jahr 1948, fiel unser Land in die Hände der Kommunisten. Mit der Demokratie war es auf einen Schlag vorbei, und meine Familie wurde erneut ins Exil getrieben. Auf den Tag genau drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs trafen wir in den Vereinigten Staaten ein, wo man uns unter dem wachsamen Blick der Freiheitsstatue als Flüchtlinge willkommen hieß. Um mich, meine Schwester Kathy und meinen Bruder John zu schonen und unser Leben möglichst normal erscheinen zu lassen, erzählten uns unsere Eltern nicht, was wir erst Jahrzehnte später erfahren sollten: dass drei unserer Großeltern und zahlreiche Tanten, Onkel sowie Cousinen und Cousins zu den Millionen Juden gehörten, die durch das Verbrechen, in dem der Faschismus gipfelte, den Holocaust, umgekommen waren.
Ich war elf Jahre alt, als ich in die Vereinigten Staaten kam, und hatte keinen größeren Ehrgeiz, als ein typischer amerikanischer Teenager zu werden. Ich legte meinen europäischen Akzent ab, las stapelweise Comichefte, hing ständig mit dem Ohr am Transistorradio und wurde süchtig nach Kaugummi. Ich tat alles, um mich anzupassen, aber irgendwo tief in mir war auch stets der Gedanke, dass wir in einer Zeit leben, in der in weiter Ferne getroffene Entscheidungen Tod oder Leben bedeuten konnten. Später, in der Schule, gründete ich einen Klub für Außenpolitik, ernannte mich selbst zu dessen Präsidentin und regte zu Diskussionen über alle möglichen Themen an, vom Titoismus bis hin zu Gandhis Grundhaltung der Satyagraha (»Die Kraft, geboren aus Wahrheit und Liebe«).1
Meine Eltern genossen die Freiheiten, die wir in unserer Wahlheimat vorfanden. Mein Vater, der schon bald eine Stellung als Professor an der Universität von Denver erhielt, schrieb Bücher über die Gefahr der Tyrannei und machte sich Sorgen, die Amerikaner könnten sich so sehr an die Freiheit gewöhnt haben – sich »allzu frei« fühlen, wie er schrieb –, dass sie die Demokratie womöglich als selbstverständlich betrachteten. Nachdem ich selbst eine Familie gegründet hatte, rief mich meine Mutter jedes Jahr am 4. Juli an, um nachzuprüfen, ob ihre Enkelkinder auch wirklich patriotische Lieder sangen und an der Parade teilgenommen hatten.
Viele Menschen in den Vereinigten Staaten neigen dazu, die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg zu romantisieren – sich eine Periode himmelblauer Unschuld auszumalen, in der sich alle einig waren, dass Amerika ein großartiges Land sei, dass jede Familie einen verlässlichen Ernährer hatte und die neuesten Haushaltsgeräte besaß, dass die Kinder alle Erwartungen übertrafen und die Lebensperspektive einfach nur rosig war. In Wahrheit jedoch herrschte in der Zeit des Kalten Kriegs ständig Angst, nicht nur vor dem immer noch bedrohlichen Schatten des Faschismus. Als ich im Teenageralter war, entdeckte man in den Zähnen von Babys eine gegenüber dem natürlichen Normalwert fünfzigmal höhere Konzentration des radioaktiven Elements Strontium 90 – eine Folge der Atomtests. Praktisch jede Stadt verfügte über eine Zivilschutzleitung, die auf den Bau von privaten Atomschutzbunkern drängte, bevorratet mit Dosengemüse, einem Monopoly-Spiel und Zigaretten. Die Kinder in den Großstädten erhielten Metallmarken mit ihrem eingeprägten Namen, damit man sie identifizieren konnte, sollte das Schlimmste eintreten.
Als ich älter wurde, trat ich in die Fußstapfen meines Vaters und wurde Professorin. Zu meinen Spezialgebieten gehörte Osteuropa, deren Staaten als Satelliten einer totalitären Sonne abgetan wurden. Es galt als abgemacht, dass dort niemals etwas Interessantes geschehen und sich nie etwas Bedeutendes ändern würde. Marx’ Traum vom Arbeiterparadies war zu einem orwellschen Albtraum verkümmert; Konformität galt als höchstes Gut, Spitzel beobachteten mit Argusaugen jeden Wohnblock, ganze Länder lebten hinter Stacheldraht und Regierungen behaupteten, Unten sei Oben, Schwarz sei Weiß.
Als sich dann schließlich doch etwas veränderte, erfolgte dies in einem Tempo, das staunen ließ. Im Juni 1989 führten in Polen die jahrzehntelang erhobenen Forderungen von Werftarbeitern und das Wirken eines in Wadowice geborenen Papstes eine demokratische Regierung herbei. Im Oktober desselben Jahres wurde in Ungarn eine demokratische Republik proklamiert, und am 9. November fiel die Berliner Mauer. In diesen wundersamen Tagen meldeten unsere Fernsehsender jeden Morgen Dinge, die lange unmöglich erschienen waren. Unvergesslich sind mir die großen Momente der Samtenen Revolution in meinem Geburtsland, der Tschechoslowakei – einer Revolution, die diese Bezeichnung erhielt, weil sie weitgehend ohne Waffengewalt und Blutvergießen verlief. Es war an einem frostig kalten Nachmittag Ende November. Auf dem historischen Wenzelsplatz in Prag ließen 300 000 Demonstranten ihre Schlüssel klingeln, gleichsam als Glocken, die das Ende der kommunistischen Herrschaft einläuteten. Auf einem Balkon über der Menge stand Václav Havel, der mutige Dramatiker, der sechs Monate zuvor als politischer Häftling eingekerkert gewesen war und fünf Wochen später den Amtseid als Präsident einer freien Tschechoslowakei ablegen sollte.
In jenem Moment gehörte ich zu den vielen Menschen, die spürten, dass die Demokratie ihre härteste Prüfung bestanden hatte. Die einst mächtige UdSSR, mürbe geworden durch wirtschaftliche Schwäche und ideologische Fadenscheinigkeit, zerbarst wie eine umgestürzte Vase auf dem harten Steinboden, wodurch die Ukraine, der Kaukasus, die baltischen Staaten und Zentralasien die Freiheit gewannen. Das nukleare Wettrüsten endete, ohne dass jemand pulverisiert wurde. Im fernen Osten schüttelten Südkorea, die Philippinen und Indonesien ihre langjährigen Diktatoren ab. Im Westen machten die lateinamerikanischen Militärherrscher den Weg für gewählte Präsidenten frei. In Afrika befeuerte die Freilassung Nelson Mandelas – auch ein politischer Häftling, der später Präsident seines Landes wurde – die Hoffnung auf eine Wiederauferstehung der ganzen Region. Weltweit gesehen wuchs die Zahl der Länder, die die Bezeichnung »Demokratie« verdienten; Ende der Achtzigerjahre waren es nur 35, doch nur zwei Jahre später waren es mehr als 100 Staaten.
Im Januar 1991 verkündete George H. W. Bush vor dem US-Kongress, das Ende des Kalten Kriegs sei »ein Sieg für die gesamte Menschheit«; Amerikas Führerschaft habe »auf entscheidende Weise dazu beigetragen, dies möglich zu machen«.2 Auf der anderen Seite des Atlantiks ergänzte Havel: »Europa strebt danach, eine historisch gesehen neue Ordnung zu erschaffen durch den Prozess der Vereinigung … ein Europa, in dem der Mächtigere nicht länger in der Lage sein wird, den weniger Mächtigen zu unterdrücken, in dem es nicht mehr möglich sein wird, Konflikte gewaltsam zu lösen.«3
Heute, mehr als ein Vierteljahrhundert später, müssen wir uns fragen, was aus jener hehren Vision geworden ist; warum scheint sie immer mehr zu verblassen, anstatt klarer zu werden? Warum ist die Demokratie heute »Angriffen ausgesetzt und auf dem Rückzug«, wie die NGO Freedom House konstatiert?4 Warum versuchen viele Menschen in Machtpositionen, das öffentliche Vertrauen in Wahlen, in die Justiz, in die Medien und – was die grundlegenden Fragen zur Zukunft unseres Planeten angeht – in die Wissenschaft zu untergraben? Warum ließ man zu, dass sich gefährliche Spaltungen entwickelten wie die zwischen Reich und Arm, Stadt und Land, Gebildeten und Ungebildeten? Warum haben die Vereinigten Staaten – zumindest vorläufig – ihre globale Führungsrolle aufgegeben? Und warum müssen wir sogar jetzt noch, im 21. Jahrhundert, erneut über Faschismus sprechen?
Ein Grund dafür ist, offen gesagt, Donald Trump. Wenn wir uns den Faschismus als eine alte, fast verheilte Wunde vorstellen, bedeutete Trumps Amtsantritt im Weißen Haus, den Verband herunterzureißen und am Schorf zu kratzen.
Für die politische Klasse Washingtons – Republikaner, Demokraten und Unabhängige gleichermaßen – war die Wahl Trumps derart bestürzend, dass ein Komiker in einem alten Stummfilm in einem solchen Fall seinen Hut mit den Händen gepackt und ihn sich über beide Ohren gezogen hätte, wonach er abrupt hochgesprungen und geradewegs auf dem Hintern gelandet wäre. Die Vereinigten Staaten hatten auch früher schon Präsidenten mit Fehlern; genau genommen hatten wir nie andere, aber wir hatten in neuerer Zeit noch nie einen Regierungschef, dessen Äußerungen und Handlungen so sehr allen demokratischen Idealen spotteten.
Von Beginn seines Wahlkampfs an bis zum Einzug ins Oval Office hat sich Donald...