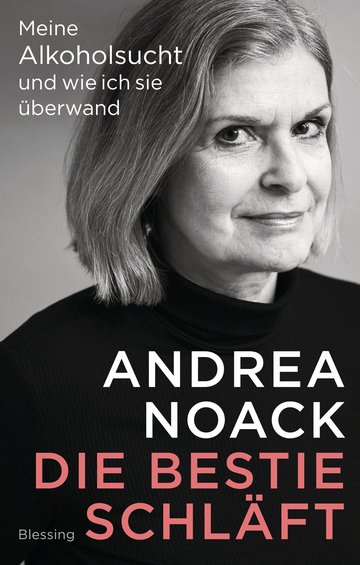Hallo, ich bin Andrea
»Hallo. Ich heiße Andrea und bin Alkoholikerin.«
Nicht, dass es mir leichtfällt, das zuzugeben. Ich habe mir das hart erarbeitet. Sieben Jahre lang, genau gesagt.
Früher sagte ich immer: »Hallo, ich bin Andrea und habe ein Problem mit Alkohol.« Ich konnte das Wort »Alkoholikerin« einfach nicht aussprechen.
Alkoholikerin, wie hört sich denn das an? Das klingt ja, als hätte ich mir schon zum Frühstück mit zitterigen Händen eine Pulle Wodka an den Hals gesetzt. Oder beim Holsten-Club an unserem Kiosk mitgemacht, wo die Vollzeitalkoholiker schon morgens mit ihren Döschen und Kurzen im Park stehen und Party machen, während unsereins mit dem Bus zur Arbeit fährt. So ungefähr bis zehn Uhr vormittags sind sie noch ansprechbar und grüßen nett, danach verstehst du kein Wort mehr. So sehr lallen sie. Das sind Alkoholiker. Aber ich?
Und dann das Wort »trocken«. Dabei denkt man doch an ein Kleinkind, das nicht mehr in die Hose macht. »Trockene Alkoholikerin« klang für mich nach schmutzigen Klamotten, Tatterich, gelalltem Blödsinn und Delirium mit weißen Mäusen. Deshalb sagte ich immer: »Ich lebe abstinent.« Oder: »Ich trinke keinen Alkohol.« Das könnte auch ein gläubiger Muslim sagen. Oder ein Pietist aus dem Schwäbischen.
Noch schlimmer: »nasser Alkoholiker«. Dieser Begriff verbindet all das, was ich bei den Neuzugängen auf der Suchtstation gesehen habe. Vollgekotzt. Vollgepisst. Vollgeschissen. Abszesse. Furunkel. Krampfanfälle. Eiterpickel und Veilchen im Gesicht. Keine Zähne mehr. Keine Kohle mehr. Keine Erinnerung mehr. Gebrochene Arme und Beine. Gehirn und Schließmuskel außer Funktion. So verschwinden sie in ihren Betten. Stündlich geht eine Schwester rein. Und nach einer Woche stehen sie auf, sind frisch und sauber und die nettesten Menschen, die dir je begegnet sind.
Heute weiß ich, dass das alles nur die Spitze des Eisbergs ist und Endstation einer langen Trinkerkarriere. Denn die allermeisten nassen Alkoholiker sehen ganz normal aus, wie du und ich, und sie sind mitten unter uns.
Praktizierende Alkoholiker*innen sitzen abends beim Italiener und lassen sich zwei, drei, ach, heute mal vier Kännchen Chianti bringen. Sie gehen jeden Morgen arbeiten, und abends gönnen sie sich zur Entspannung zwei, drei, vier, vielleicht fünf Bier. Ausnahmsweise auch mal sechs. Sie holen ihre drei Kinder vom Kindergarten und von der Schule ab und bringen sie mit dem Fahrrad nach Hause – eins vorne-, eins hintendrauf, das älteste fährt mit seinem kleinen Puky-Fahrrad vorneweg.
Wenn sie sich mit ihren Mütter-Freundinnen treffen, gibt es zwei, drei Gläser Prosecco. Sie arbeiten hart und haben ihr Leben im Griff, deshalb gönnen sie sich abends eine Flasche guten Rotwein. Sehr guten. Nach einer Weile werden es anderthalb. Irgendwann sind es plötzlich zwei.
Auch ich konnte viele Jahre lang jeden Abend ein, zwei Gläser Rotwein trinken. So lange, bis ich es nicht mehr konnte. Irgendwann musste ich immer weitertrinken. So lange, bis ich vom Stuhl oder ins Bett fiel. Oder eins nach dem anderen.
Jahrelang gehörte ich zu den funktionierenden Alkoholikern. Bei ihnen fällt es nicht auf, dass sie ein Suchtproblem haben, weil sie noch einem Job nachgehen und sozial integriert sind. Oft verdienen sie viel Geld oder arbeiten in kreativen Berufen. Oder beides. Zum Beispiel in einer Werbeagentur oder einer Filmproduktion, wo ohnehin gesoffen und gekokst wird und es nicht weiter auffällt, wenn die halbe Belegschaft um zwanzig Uhr stramm ist wie die Radehacken.
Entschließt du dich dann, der Trinkerei ein Ende zu machen und von nun an nüchtern zu bleiben, gehen die Probleme erst richtig los. Nicht genug, dass es dir wahnsinnig schwerfällt, auf deine gewohnten Drinks zu verzichten. Du wirst auch noch blöd angemacht dafür. Als Spaßbremse oder Spielverderber. Als Gesundheitsapostel oder Besserwisser. Als Langweiler, Spießer oder blöde Kuh, Gutmensch oder Tugendbold. »Mit Andrea ist nichts mehr anzufangen«, heißt es dann. »Mit dem Typen kannst du keinen Spaß mehr haben.« Oder: »Das ist ein ganz komischer Kauz geworden.« Und irgendwann stellst du plötzlich fest, dass du nicht mehr eingeladen wirst und keine Freunde mehr hast. Dann bleiben dir genau zwei Möglichkeiten: Entweder du wirst rückfällig und machst weiter wie zuvor, oder du suchst dir einen neuen Job und neue Freunde. Wie jeder andere Junkie auch.
Wirtschaftswunder
Wann das mit dem Alkohol richtig losging, weiß ich gar nicht mehr.
Eigentlich fing alles sehr vielversprechend für uns an: Der Krieg war vorbei, es wurde für den Wiederaufbau der Bundesrepublik in die Hände gespuckt und viel Geld verdient, wir waren die Kinder des Wirtschaftswunders und immer gut angezogen. Oft waren wir die Ersten in der Familie, die aufs Gymnasium gehen und Abitur machen durften. Was einige von uns jedoch nicht wirklich zu schätzen wussten, sondern so lange von allen möglichen Schulen flogen, bis ihre Eltern sie auf teure Internate, wie am Bodensee oder am Solling, verfrachten mussten. Oder bis sie ohne Abitur irgendwo im Getriebe der Gesellschaft versandet sind.
Ich war ein hübsches und intelligentes Kind und ein braves Mädchen. Damals war es noch etwas Besonderes, gut auszusehen. Nur Filmstars waren schön, der Rest der Menschheit war farblos oder hässlich. Umso merkwürdiger kommt es mir vor, dass ich mit anderen Menschen Schwierigkeiten hatte, seit ich denken kann. Immer wieder geriet ich in ausweglose Situationen, in denen es ganz schlecht für mich aussah, ich nicht weiterkam, keinen Pfennig Geld mehr hatte oder sogar verprügelt wurde. Das konnte ich mir nicht erklären. Was machte ich nur falsch?
Babyboomer
Ich gehöre zur Generation der sogenannten Babyboomer. Das sind die Leute, von denen es einfach zu viele gibt. Wir sind diese rund zwanzig Millionen Menschen umfassende Kohorte der Nachkriegsjahre, also ein Viertel Deutschlands. Wir wurden vor dem Pillenknick 1966 geboren und werden auch die geburtenstarken Jahrgänge genannt. Für uns war alles zu klein: die Kindergärten, die Schulen, die Sporthallen, die Schwimmbäder, die Ausbildungsbetriebe, die Universitäten, die Unternehmen, die uns einstellen sollten. Als demografisches Monster wabern wir schon seit Jahren durch die Medien.
Wir haben gemeinsam die wilde Zeit erlebt, und so wild wurde sie nie wieder.
Die Hippies verbreiteten mit ihrer Musik und dem Qualm ihrer Joints die Botschaft von Liebe und Frieden. Sie entdeckten unter Zuhilfenahme synthetischer Substanzen völlig neue Sphären menschlichen Bewusstseins und machten sie für eine breite Öffentlichkeit zugänglich.
Die außerparlamentarische Opposition pustete den Muff von tausend Jahren unter den Talaren hinfort wie mit einem Laubbläser. Die Frauen beanspruchten das Eigentumsrecht an ihrem Bauch und weigerten sich, nur noch das fleißige Lieschen oder der gute Geist für Papi zu sein, ganz gleich, ob er Handwerker, Chefredakteur oder Bundespräsident war.
Und wir, die etwas später kamen, profitierten davon.
Ich bin 1958 geboren. Zu spät, um einer der in letzter Zeit mit nichts als Häme überschütteten 68er zu sein. Mist. Als ich mit vierzehn Jahren begriff, dass Woodstock unwiderruflich vorbei war und ich ein solches Happening vermutlich nie erleben würde, vergoss ich bittere Tränen. Das tat ich auch, als ich realisierte, dass die Beatles schon getrennt waren, bevor ich überhaupt von ihrer Existenz gewusst hatte.
Doch auch wir Jüngeren brachten einiges zustande. Zum Beispiel 1982 eine der größten Friedensdemos überhaupt. Fast eine halbe Million Menschen protestierte damals in Bonn gegen die atomare Aufrüstung.
Auf der Suche nach Erleuchtung machten wir uns mit dem Bulli auf den Weg nach Indien. In Griechenland beschlossen wir, dass wir erleuchtet genug waren und uns die Weiterreise sparen konnten. Dann saßen wir um ein Lagerfeuer am Strand, sangen Lieder von Simon & Garfunkel oder Crosby, Stills & Nash und steckten ein paar von den Steinen in die Tasche, über die vielleicht schon Parmenides gewandelt war. Oder Sokrates. Oder Platon. Oder alle drei. »The Boxer« war bei jedem Lagerfeuer unsere Hymne – ob beim Klassenfest oder im Urlaub. Wir stiegen in unseren R4 oder unsere Ente und fuhren mit Minimalgepäck nach Frankreich, zelteten wild an der Ardèche oder im Pinienwald vor Biarritz, bis wir von den französischen Gendarmen erwischt wurden und auf den Campingplatz mussten.
Und wir waren viele.
Das sind wir immer noch, obwohl der Tod schon einige von uns dahingerafft hat.
Wenn wir bald in Rente gehen, wird wieder etwas zu klein für uns sein: die Rentenkasse. Denn das schöne Geld, das wir einbezahlt haben, ist längst von unseren Eltern und Großeltern mit vollen Händen ausgegeben worden. So könnte es sein, dass der in jeder Hinsicht üppige Beginn unseres Daseins in einen kargen Lebensabend mündet.
Die eine Hälfte der Babyboomer hat eine großartige Karriere hingelegt. Sie wurden Filmregisseur*in, Lehrer*in, Hochschulprofessor*in, Schriftsteller*in, Unternehmensberater*in, Product Manager*in, Dolmetscher*in, Rechtsanwält*in, Texter*in, Agentur-Inhaber*in, Unternehmer*in, Politiker*in, Lobbyist*in, Spekulant*in, Millionär*in, Außenminister oder Bundeskanzlerin.
Die andere Hälfte dümpelt recht und schlecht vor sich hin. Oder auf und ab. So wie ich.
So eng es jedoch überall für uns gewesen ist, eines gab es für uns immer in Hülle und Fülle: was zu trinken. Hier ein Schlückchen, dort ein Gläschen. Hier ein Bierchen, dort ein Schnäpschen. Ex und hopp und de Schoppe in de Kopp. Nicht lang...