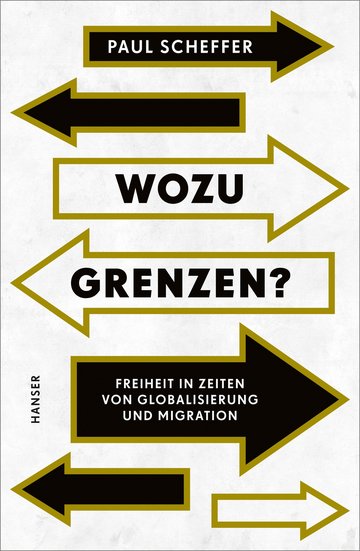Grenzerkundungen
Mit achtzehn stand ich zum ersten Mal an der Mauer, die Berlin in zwei Teile schnitt. Ich sah die gespenstische Szenerie von der ostdeutschen Seite aus, als einer der Abgesandten, die unser Land bei den Weltfestspielen der Jugend im Sommer 1973 vertraten. Wir waren am Rand der Stadt einquartiert, und von meinem Fenster aus konnte ich aus der Nähe die Wachtürme und Scheinwerfer entlang der Mauer sehen. Die offizielle Bezeichnung lautete Antifaschistischer Schutzwall, doch in Wirklichkeit handelte es sich um eine Ummauerung des Kommunismus. Der »Schutzwall« stand dort, um die eigenen Bürger am Verlassen der DDR zu hindern.
Sechzehn Jahre später stand ich eines Sonntagmorgens auf dem Potsdamer Platz und beobachtete, wie dort ein Kran das erste Segment der Mauer aus seinen Fugen zog. Drei Tage zuvor, an jenem historischen 9. November 1989, war die Mauer gefallen. Eine riesige Menschenmasse hatte sich versammelt. Ich stützte mich auf die Schulter eines fröhlichen Grenzpostens, um das Schauspiel besser betrachten zu können. Achtundzwanzig Jahre lang war dieser ehemalige Verkehrsknotenpunkt der Stadt eine unüberwindliche Barriere gewesen. Jetzt füllte das Niemandsland eine ausgelassene Menge, und so erlebten wir den Beginn einer neuen Idee vom Alten Kontinent.
Ich erinnere mich noch gut an das Gefühl der Erleichterung während der Jahre nach dem Kalten Krieg. Endlich waren wir von diesem Eisernen Vorhang erlöst, der Europa so brutal geteilt hatte. Die Herrschaft Moskaus über den östlichen Teil des Kontinents war beendet, und die sogenannte »Friedensdividende« wurde schnell verprasst. Bei der Verteidigung konnte man kräftig sparen, denn die Sorgen hinsichtlich der territorialen Integrität und Grenzsicherung gehörten der Vergangenheit an. Nach der Wende von 1989 würde alles anders werden.
Und jetzt, ein Vierteljahrhundert später, reden wir fortwährend über Grenzen. Der Zustrom von Hunderttausenden von Flüchtlingen beschäftigt die Gemüter. Es scheint Einigkeit darüber zu geben, dass es notwendig ist, die europäischen Außengrenzen besser zu schützen, doch diese Einigkeit zieht zu wenig Tatendrang nach sich. Entscheidungen werden auf die lange Bank geschoben. Das hat auch mit einer moralischen Verlegenheit zu tun: Mit welchem Recht können wir anderen verbieten, sich bei uns niederzulassen?
In diesem Buch geht es um die offene Gesellschaft und ihre Grenzen. Zurückblickend wird mir bewusst, dass mir dieses Thema schon lange durch den Kopf geht. Es ist mehr als ein Thema unter anderen, denn letztendlich war es die Suche nach Grenzen, die mich zum Schreiben angespornt hat. In meinem Fall entspringt das Bedürfnis, etwas in Worte zu fassen, aus dem Willen, Dinge zu ordnen. Das ist der einzige Weg, das Chaos zu bezwingen, denn wer sich der Welt öffnet, der fühlt sich sehr bald schon durch die Vielzahl der Ereignisse, durch das Tempo, mit dem ein Eindruck den anderen verdrängt und durch die Kakophonie der Ideen, die umgehen, überfordert. Ich habe jedenfalls das starke Bedürfnis, die Welt in meinem Kopf mit Argumenten zur Ruhe zu bringen.
Dazu gehört das Pendeln zwischen innen und außen: Nachdem ich mich für eine Zeit ins Getümmel gestürzt habe, suche ich stets wieder die Stille. Um die Dinge in ihrem Zusammenhang zu erkennen, muss ich die Außenwelt auf Distanz halten. Mehr noch: Nur indem ich eine Innenwelt pflege, bin ich in der Lage, mein kleines Ideengebäude zu errichten. Gerade durch die Abgrenzung werden Gedanken an die Oberfläche gezwungen. Das habe ich mein Leben lang mit mehr oder weniger Erfolg versucht zu tun. Die Straße und das Arbeitszimmer gehören zusammen, doch alles hat seine Zeit, die Innenwelt und die Außenwelt dürfen sich nicht zu stark vermischen.
So betrachtet ist es nicht verwunderlich, dass ich schon lange versuche, über die Bedeutung von Grenzen nachzudenken. Am Anfang meiner Erkundungen stand eine Mischung aus Neugierde und Angst, Triebfedern, die ich nie als etwas Gegensätzliches empfunden habe. Vielleicht ist die Kombination dieser beiden Beweggründe ja sogar die Wurzel aller Grenzerkundungen: Die Bedrohung, die von etwas Unbekanntem ausgehen kann, hat mich oft dazu gebracht, in fremden Territorien umherzustreifen. Letztendlich siegte in den meisten Fällen die Neugierde über die Furcht. Ich habe meine Ängste im Zaum gehalten, indem ich auf alles zugegangen bin.
Die Aggression, die nach der Veröffentlichung meines Essays über das »multikulturelle Drama« im Januar 2000 in der Luft hing, steht mir noch deutlich vor Augen. Das war keine schöne Zeit, doch indem ich fast alle Einladungen zu Lesungen oder Diskussionen annahm, konnte ich den Widerstand, den ich bei manchen hervorgerufen hatte, zu mir durchdringen lassen. Zugleich gab ich den Menschen die Möglichkeit, ihre Wut in Worte zu fassen. Durch den Austausch der Argumente gelang es oft, für ein Auftauen der frostigen Atmosphäre zu sorgen. Der Organisator eines Treffens in türkischen Kreisen schickte mir nach einem wieder einmal schwierigen Gespräch einen freundlichen Brief, in dem er auf ein Sprichwort verwies: »Ein wahrer Freund spricht auch bittere Worte.«
Mich interessiert, was auf der anderen Seite der Grenze passiert. Darum habe ich der Vorstellung, dass wir in einem Land ohne Grenzen leben, immer misstraut. Dieses Selbstbild zeugt von einer ausgesprochen nach innen gewandten Haltung. Denn was gibt es noch zu entdecken, wenn es keine Außenwelt mehr gibt? Den Wert des Überschreitens von Grenzen kann nur der verstehen, der bereit ist, die Bedeutung von Grenzen zu erkennen.
Die Neugierde habe ich mit der Muttermilch eingesogen: Mein Großvater, Herman Wolf, wurde in Köln geboren, der andere, Lou Scheffer, in Batavia, dem heutigen Jakarta. Bereits früh wurde mir zu verstehen gegeben, dass es auf der Welt nicht nur die Niederlande gibt. Ich bin in einem liberalen Milieu aufgewachsen, in dem man die Romane von Jean-Paul Sartre und Heinrich Böll verehrte — eine kleine französisch-deutsche Versöhnung. Doch auch der Jazz von Nina Simone und Stan Getz wurde gerne gehört — eine kleine schwarz-weiße Versöhnung.
Das Einzige, wofür es bei uns zu Hause kein Verständnis gab, war Religion; die betrachtete man als Quell aller Intoleranz. Mich interessierte Religion durchaus. Einmal kaufte ich als Schüler eine Bibel und bekam dafür einen Rüffel von meiner Mutter. Ein solches Buch wollte sie nicht im Haus haben: »Lies lieber die Bücher von Jan Wolkers, davon hast du mehr.« Ich weiß nicht, ob sie damit recht hatte, aber ich weiß wohl, dass Wolkers, der sich in seinen oft freizügigen Texten kritisch mit dem calvinistischen Milieu seiner Jugend auseinandersetzte, dieser Ansicht entschieden widersprochen hätte.
Außer der Neugierde wurde mir auch die Furcht schon in jungen Jahren mitgegeben. Manchmal denke ich, dass Ängste subkutan von Generation zu Generation weitergereicht werden. Als ich nach dem Tod meiner Mutter ihre Wohnung auflöste, fand ich den aus der Zeit der Besatzung stammenden Haftbefehl für meinen Vater und ein paar Briefe, die er aus dem Lager in Amersfoort an seine Eltern geschrieben hatte. Der Krieg war bei uns nie ein Gesprächsthema, die Kinder durften damit nicht belastet werden. Gleichzeitig war die Geschichte überaus präsent, gerade weil es unvorstellbar war, darüber zu reden.
Die Grenze ist für mich zunächst eine Kindheitserinnerung: Es gab eine Grenze, die wir nicht überschreiten durften, die zu Deutschland. Meine Mutter wollte das nicht, bis weit in die Siebzigerjahre hinein. Das war merkwürdig, denn wir wohnten in unmittelbarer Nähe der Grenze, in Arnheim. Die Grenzstation in ihrem Kopf war eine Reminiszenz an ihren jüdischen Vater, der um die Jahrhundertwende mit seinen Eltern nach Amsterdam gezogen war. Wir durften die Grenze nicht überqueren, die er zuvor in umgekehrter Richtung überschritten hatte.
Herman Wolf war mein Großvater mütterlicherseits. Sein Leben und Werk im Amsterdam der Dreißigerjahre war Teil einer literarischen Generation, die sich für den Humanismus begeisterte, die aber zugleich von einem tiefen Pessimismus erfüllt war. Philosophisch geprägt durch Schopenhauer und Nietzsche, doch auch gezeichnet durch den Ersten Weltkrieg, stand diese Generation am Beginn eines Jahrhunderts, das heute als ein Zeitalter der Extreme umschrieben wird. Wolf erlebte den Aufstieg von totalitären Strömungen, und er versuchte, dem einen sanftmütigen Humanismus gegenüberzustellen.
Ein Schock des Wiedererkennens traf mich, als ich vor Jahren las, was Herman Wolf im fatalen Jahr 1933, kurz nach der Machtübernahme durch Adolf Hitler, schrieb: »Das ist die problematische, ja tragische Situation...