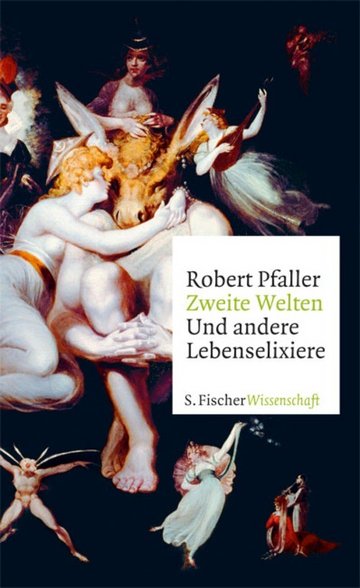Vorwort
Dieses Buch geht der Frage nach, wovon wir träumen müssen, um etwas Anderes leben zu können. Welche fiktiven Welten müssen wir produzieren, um eine andere, wirkliche Welt realisieren oder in Gang halten zu können?
Fragen wie diese scheinen im Moment ein wenig in Vergessenheit geraten zu sein. Im Maßstab des individuellen Lebens haben postmoderne Identitätspolitiken uns die Vorstellung nahegelegt, jeder, jede und jedes wäre nur einer, eine und eines, und sonst nichts. Dass man, gerade um etwas Bestimmtes zu sein, vielleicht noch etwas Zweites, Anderes sein, oder es wenigstens als Fiktion mit sich tragen muss, fällt gerade in der Postmoderne schwer zu denken – was möglicherweise zur unglücklichen Unabschließbarkeit der »Selbstkonstruktionen« beiträgt, mit der viele Individuen derzeit beschäftigt scheinen: Es gelingt ihnen eben bezeichnenderweise kaum jemals, jenes mythische Eine zu finden, das sie angeblich voll und ganz sein könnten und sollten. Auch im Liebes- und Beziehungsleben besteht große Unduldsamkeit gegen zweite Welten: Gemäß einer postmodernen »Verhandlungsmoral« sollen alle einfach sagen, was sie wollen, und dann, so denkt man, werden sie es doch wohl auch bekommen. Im Fernsehen erklären Ehepaare stolz oder trotzig, sie hätten keine Geheimnisse voreinander. Gleichzeitig zeigen Studien, dass Liebespartner ohne jedes Geheimnis meistens auch als reizlos empfunden werden und dass der Verzicht auf jegliche Fiktion auch die Wirklichkeit des Liebes- und Sexuallebens zum Erliegen bringt.
Auf politischer Ebene hat die Postmoderne uns mit dem »Ende der großen Erzählungen« vertraut gemacht. So scheint es, dass nur frühere Epochen an etwas Bestimmtes geglaubt hätten, während sie munter etwas anderes zur Realisierung brachten. Wir dagegen glauben angeblich an nichts mehr, und das mag unsere Unfähigkeit zu jeglichem Handeln und zum politischen Engagement erklären. Freilich aber erklärt es andererseits nicht die beeindruckende Initiativkraft, mit der die Profiteure der internationalen Finanzmärkte in den letzten Jahrzehnten sich selbst sehr reich und die Gesellschaften unerwartet arm gemacht haben. Unter der Annahme, dass hier nichts geglaubt worden wäre, wird übersehen, welche Einbildungen zu solchen Aktivitäten nötig waren und in welchen Institutionen und politischen Maßnahmen diese Einbildungen materielle Gestalt annehmen mussten, um die neoliberalen Wirklichkeiten zu stützen. Ohne die Erkenntnis der idyllischen zweiten Welten, die hier am Werk waren, übersieht man auch, welche Chancen es gibt, den grausamen ersten Welten Schwierigkeiten zu machen. Die verbreitete Vorstellung von der Ungreifbarkeit des neoliberalen Feindes, jenes mythischen »1 percent« von Nutznießern, würde sich schlagartig ändern, sobald man in Betracht zieht, wie viele kleine Nebenprofiteure und pseudopolitische Komplizen nötig waren, um den großen Profiteuren ungestörtes Arbeiten zu ermöglichen. Wer den einen, großen Feind nicht finden kann, tut vielleicht gut daran, sich mal nach dessen vielen kleinen Gehilfen umzusehen.
So sehr die Postmoderne also die Individuen zur Einheitlichkeit mahnt, erlaubt sie sich selbst in ihrer neoliberalen Wirklichkeit ein Doppelleben – einen Paarlauf von Großprofiteuren und Kleinbeschwichtigern. Die Individuen werden homogenisiert; alles Zweite, Randständige sollen sie in ihrem Ich unterbringen. Die Gesellschaft dagegen fährt mindestens zweigleisig, aber dies bleibt aufgrund unserer zunehmend homogenisierten Sehgewohnheiten mehr und mehr unsichtbar.
Freilich treten in der Postmoderne auch tatsächlich homogen anmutende Individuen auf: Sie sind zum Beispiel ganz Primitive (etwa als rückhaltlose Komatrinker), total Schamlose (in Gestalt pornofixierter Unterschichtler), völlige Idioten, vollkommen Hilflose und Schwache etc. Allerdings sind diese neuen Phänomene, wie wir zeigen möchten, immer Effekte ihrer Betrachtung. Diese Leute »sind« deshalb so, weil sie das Gefühl haben, dass es jemanden gibt, der sie gerne so sehen möchte. Für diese Zusammenhänge hat Sigmund Freud den Begriff der »Übertragung« entworfen. Übertragung besteht darin, dass jemand im Verhältnis zu jemand anderem etwas produziert, was sonst, ohne Übertragung, innerhalb eines Individuums alleine, im konfliktuellen Verhältnis seiner psychischen Instanzen, verhandelt werden müsste. In der Übertragung ersetzt nun das zwischenmenschliche Verhältnis das innerpsychische. So kommt es, dass Leute im Verhältnis zu anderen zum Beispiel eine Schamlosigkeit an den Tag legen, die sie sich selbst niemals gestatten würden. Wenn es ihnen gelingt, ihr Über-Ich auszulagern und es an andere zu delegieren, dann sind sie den innerpsychischen Konflikt los, und sie können sich voll und ganz und ungeniert der einen Seite dieses Konflikts widmen – also zum Beispiel der Schamlosigkeit. Die anderen, die nun als ihr Über-Ich fungieren, werden sie dann schon einschränken oder aber – was gegenwärtig eben häufiger vorkommt – sie sogar dafür loben oder lieben.
Hier schließt sich der Zusammenhang zu den aktuellen gesellschaftlichen Verhältnissen. Denn das, was gegenwärtig die zweite, zartbesaitete Welt eines aggressiven Umverteilungskapitalismus ausmacht, sind Institutionen und Maßnahmen, die immer unter Berufung auf vermeintlich ganz schwache Individuen ins Leben gerufen werden: Man tut etwas für die ganz Bildungsfernen oder die völlig Schutzlosen. Meistens freilich besteht das, was man auf diese Weise tut, darin, dass ein bestehender gesellschaftlicher Standard demontiert wird: Man nimmt den Leuten die Möglichkeit, sich als politische Bürger zu äußern und nicht nur als unterhaltsame Freaks; man gibt Frauen das Gefühl, ewig förderungsbedürftige Wesen zweiter Klasse zu sein, und nicht ebenbürtige, entscheidungsfähige Kräfte; man zerstört die Universitäten als Orte kritischen Nachdenkens und verwandelt sie in öde Zwangslernanstalten; und man diskreditiert im Namen von irgendwelchen hastig herbeigerufenen Phantomen unendlich Schwacher jede politische Initiative, die droht, die entscheidenden Fragen gesellschaftlicher Umverteilung zu berühren.
Die Erkenntnis der Übertragung, die zwischen den vermeintlich homogenen Individuen und denjenigen besteht, die sie so schwach sehen wollen, ist darum gegenwärtig von entscheidendem politischem Wert: Sie bedeutet nicht weniger, als den grausamen Beraubungspolitiken der Gegenwart jenen Deckmantel aus zartfühlenden Rücksichten zu entziehen, den sie zu ihrer Durchführung nötig haben.
Beträchtliche Teile dieses Buches sind im Rahmen des Forschungsprojekts »Übertragungen. Psychoanalyse – Gesellschaft – Kunst« entstanden, das von der Forschungsgruppe für Psychoanalyse »stuzzicadenti« 2009 bis 2011 durchgeführt und vom Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) gefördert wurde; andere Teile entstanden im Zusammenhang meiner universitären Forschungs- und Lehrtätigkeit; weitere schließlich durch Anregung und Auftrag bestimmter Wissenschafts- und Kulturinstitutionen. Ich bin darum den Mitgliedern der Forschungsgruppe »stuzzicadenti«, Georg Gröller, Mona Hahn, Judith Kürmayr, Ulrike Kadi, Eva Laquièze-Waniek und Karl Stockreiter, dankbar für intensive, transdisziplinäre Auseinandersetzung; ebenso den Studierenden und Lehrenden der Universität für angewandte Kunst in Wien, der technischen Universität Wien, der Kunsthochschule Oslo (KHIO), des Piet Zwart Institute Rotterdam, der Ecole supérieure des beaux-arts de Toulouse, der Universität Zürich sowie dem Institut für Erweiterte Kunst in Linz für lohnende Herausforderungen, Anregung und Diskussion. Und schließlich den Programmverantwortlichen des Festivals »steirischer herbst«, deren Veranstaltung 2011 dem Thema »Zweite Welten« gewidmet war und die mich für den Katalog-Essay gewannen, dessen erweiterte Fassung nun den Anfang dieses Buches bildet; weiters Jela Krečič und Ivana Novak, Ljubljana, die mich für ein Symposion über Fernsehserien einluden, was den Ausgangspunkt für die Studie zu »Sex and the City« bildete; Irene Berkel, Berlin, die die Phänomene der Postsexualität zum Thema eines Symposions sowie eines Sammelbandes machte; Gerhard Zenaty, dem ich die Einladung zu einer psychoanalytischen Tagung über die Perversionen verdanke; Daniel Tyradellis, der mich für die Ausstellung »Wunder« in der Schirn Kunsthalle Hamburg und der Kunsthalle Krems für einen Katalogbeitrag gewann; Karin Gludovatz, Dorothea von Hantelmann und Michael Lüthy, die mich zur Tagung »Kunsthandeln« des Sonderforschungsbereichs der FU Berlin »Ästhetische Erfahrung im Zeichen der Entgrenzung der Künste« einluden; Martin Vöhler und Christiane Voss für die Gastfreundschaft im Exzellenzcluster »Languages of Emotion« der FU Berlin, der die Bedeutung der aristotelischen Katharsis untersuchte; sowie Daniel Kurjakovic, der mich ermutigte, ein mysteriöses, anonymes Manuskript für den Katalog »Conflicting Tales: Subjektivität« aufzubereiten. Sie alle bewiesen, dass man mitunter einen Anstoß von außen benötigt, um das zu schreiben, was man immer schon schreiben wollte. Mein Dank gilt darüber hinaus all jenen Journalistinnen und Journalisten, die mich, vor allem im Zusammenhang mit meinem letzten Buch, »Wofür es sich zu leben lohnt«, mit zahlreichen äußerst präzisen Fragen konfrontierten und mich zwangen, meine Thesen weiter zu klären, sie zu erläutern und sie auf neue Zusammenhänge anzuwenden. Die in diesem Buch entwickelte materialistische Theorie wurde auf diese Weise zugleich in ihrer Kohärenz gestärkt wie auch erweitert.
Wertvolle Hinweise, Kritik und Ermutigung...