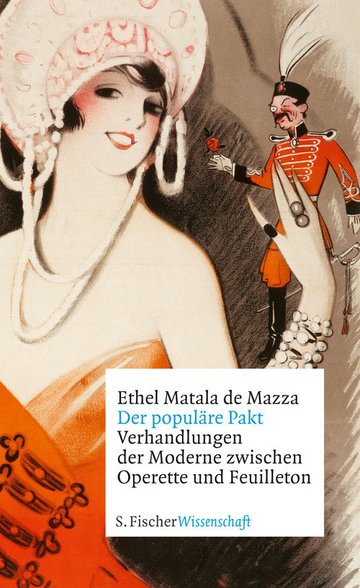Einleitung
Unter dem Titel »Krisis der Operette« veröffentlichte die Berliner Theaterzeitschrift Die Scene im Februar 1929 ein Sonderheft, das die Zukunft des Genres zur Debatte stellte. Anlass der Diskussion war der jüngste Erfolg einer Oper, die »so prunkvoll gedacht war, wie nur Bettler sie erträumen«, und dem Anspruch ihrer Autoren nach »so billig sein sollte, daß Bettler sie bezahlen können«.[1] Auf die Frage der Redaktion, ob durch Bertolt Brechts und Kurt Weills Dreigroschenoper »anstelle der noch kommenden Operettenreform bereits das Faktum oder der Weg einer neuen, zeitgemäßen Umwandlung gegeben«[2] sei, antworteten die 37 Beiträger des Hefts – darunter Komponisten, Regisseure, Librettisten, Bühnensänger und Theaterleiter – kontrovers. Einen der umfangreichsten Aufsätze steuerte Thomas Manns Schwager Klaus Pringsheim bei, der fand, dass das »typische Operettenmilieu« für die Verhältnisse der ausgehenden zwanziger Jahre »ein bißchen unmöglich« geworden sei, und damit die Meinung vieler zum Ausdruck brachte. »Das Beste wäre wohl, die ganze Gattung abzuschaffen; nur so wird sie zu retten sein«, lautete sein Kommentar. »Immer wieder ›Herr Baron‹ und ›Seine Durchlaucht‹ und ewig Sekt und münchener Fasching und pariser Cocotten und Roulette in Monte Carlo und fade Gutangezogenheit, immer dies abgestandene Parfüm von Allerweltseleganz, dieser Talmiglanz verflossener Hochherrschaftlichkeit – die Methoden verfangen nicht mehr wie einst.«[3]
Solche Aburteilungen wollte der Operettenkomponist Michael Krausz nicht auf sich sitzenlassen. Von der Operette werde etwas verlangt, »was der Gattung garnicht zusteht, LITERATUR!!!« Weil die Operette »an Alle« appelliere, nicht nur an eine »Handvoll Literaten«, gab es für Krausz nur eine Forderung: »Heraus mit den – ihren Beruf verfehlten – LITERATEN aus den Operettentheatern!«[4] Mit dem grammatisch etwas verwackelten Imperativ machte Krausz vermutlich nicht nur seinem Ärger über Brecht und Weill Luft, sondern keilte auch gegen Franz Lehár und seine beiden Textdichter Fritz Löhner und Ludwig Herzer aus, die den »Literaten« in ihrem jüngsten Bühnenwerk auf andere Weise Respekt gezollt hatten. Nur wenige Monate zuvor, am 4. Oktober 1928, war nach aufwendigen Renovierungen das Berliner Metropol-Theater mit der Lehár-Operette Friederike vor großer Prominenz wiedereröffnet worden. Im Zentrum stand Goethes Jugendliebe zu der Sesenheimer Pfarrerstochter Friederike Brion. Um die frühe Episode aus dem Dichterleben bühnenreif auszugestalten, hatten Lehárs Librettisten – der eine promovierter Jurist, der andere praktizierender Gynäkologe – sich durch Dichtung und Wahrheit und dann »in fieberhaftem Tempo« durch die »›Friederiken‹-Literatur« gearbeitet, ferner »eine stattliche Anzahl von (zirka 30) Monographien« sowie »Goethe-, Herder-, Lenzbriefe«[5] gesichtet und vor allem Goethes Gedichte studiert, deren Verse sie für die Liedpartien ihrer Bühnenfigur teils wörtlich übernahmen, teils freier umspielten. Das Ergebnis war ein abendfüllendes Melodram, in dem nicht nur das Heidenröslein in Lehárs Neuvertonung zu Operettenehren kam, sondern auch zahlreiche andere Goethe-Lieder aus der Sesenheimer Zeit und aus späteren Jahren wieder erklangen. Man »weiß nie, wo Goethe aufhört und Löhner anfängt«,[6] hob das Programmheft des Metropol-Theaters anerkennend hervor.
Dass die Welt der Literaten nicht die Welt der Operette ist, reflektiert das »Singspiel« dabei selbst, indem es nicht den Dichter Goethe, sondern Friederike zu seiner Titelheldin kürt und ihr das Schicksal zuteilt, den Dichter selbstlos ziehen zu lassen, sobald der Ruf zu Höherem an ihn ergeht. Goethes Poesie hat auf dem Theater kaum die Mädchenblütenträume reifen lassen, da wird Friederike bereits von anderer Seite an die Prosa ihrer kleinen und engen Verhältnisse gemahnt. Es ist ihr Schwager Weyland, der ernste Bedenken gegen die Verbindung hegt und Friederike mit Hilfe des Märchens von der neuen Melusine – nicht ohne anzumerken, Goethe selbst habe es »vor kurzem im Freundeskreise vorgelesen« – die aussichtslose Lage der Dinge vor Augen führt, als er von den Bemühungen des Weimarer Herzogs Karl August um Goethe erfährt.
Weyland: Ein Jüngling verliebte sich in eine geheimnisvolle, wunderschöne junge Dame und warb um sie. Da gestand sie ihm ein, daß sie die Tochter des Zwergkönigs sei.
Friederike (ein wenig beklommen): Die Tochter des Zwergkönigs.
Weyland: Ja. Nur durch einen Zauberring habe sie menschliche Größe erlangt. Sie könne ihm also nur angehören, wenn er ihresgleichen werde und auch Zwerggestalt annehmen würde. Ohne sich zu bedenken, stimmte er zu und sie steckte ihm freudestrahlend den Zauberring an seinen Finger … da wurde er auch zum Zwerg … Anfangs behagte ihm das neue Leben, aber gar bald machten ihn die kleinen und engen Verhältnisse tief unglücklich. Er sah sich oft im Traum … wie ein Riese … und schließlich beherrschte ihn nur ein Gedanke: sich zu befreien, befreien um jeden Preis! … Unter unsäglicher Mühe feilte er sich den Ring vom Finger, wuchs wieder zu seiner menschlichen Größe empor … und ohne Abschied verließ er heimlich die Geliebte.
Friederike (die immer mehr in sich gekehrt und ernster geworden, erhebt sich langsam, erschüttert): Und ohne Abschied verließ er die Geliebte – [7]
Deutlicher als mit Hilfe dieser Parabel hätte das Singspiel kaum die Maßverhältnisse zwischen den Größen der Literatur und den minderen Akteuren explizieren können, die an der Höhe, zu der sie aufschauen, bestenfalls im Imaginären einer anderen Kultur teilhaben – über andächtig bewahrte »kleine Blumen, kleine Blätter«[8] oder aber über kurze Gastspiele auf der Operettenbühne. Der Forderung Krausz’, sich »an Alle« zu richten, kommt Lehárs Friederike indirekt nach, indem sie den künftigen Dichterfürsten für den Hof »Seiner Durchlaucht des Herzogs von Weimar«[9] freigibt, während sie den Zuschauern eine kleine Protagonistin von »ihresgleichen« ans Herz legt, die ihnen in Löhners Schlagern die Lektüre von Goethes Werken ›schenkt‹. Das letzte Wort Friederikes soll jeder von sich sagen können: »Goethe gehört der ganzen Welt, also auch mir!«[10]
Wie die Allgemeinheit aussah, an die sich solche Schlager in der späten Weimarer Republik richteten – nicht nur über die Bühne, auf der Friederike die Dreigroschenoper an Popularität übertraf[11] –, erklärt die Sondernummer der Zeitschrift nicht. Auch Klaus Pringsheims Beitrag belässt es bei der Mutmaßung, dass die meisten ihrer Vertreter weniger im Theaterpublikum denn unter jenen »Anspruchslosen« zu suchen sein dürften, denen die leichte Musik »billig und bequem« »per Rundfunk in Haus geliefert« wird oder in Lokalen, Kinos und »Amüsierbetrieben«[12] begegnet. Als genügsame Konsumenten kommen die anonymen Vielen bei ihm nur flüchtig in Betracht und sind als diffuse Jedermanns nicht weiter von Interesse.
Das ändert sich, wenigstens im deutschen Sprachraum, erst mit den Fallstudien des Journalisten, Filmtheoretikers und Soziologen Siegfried Kracauer, die einer breiten Leserschaft vorführen, dass sich die Frage nach dieser Allgemeinheit Ende der 1920er Jahre keineswegs als belanglos abtun lässt. Im selben Jahr, in dem die Scene über die Krise der Operette nachdenkt, veröffentlicht Kracauer in der Frankfurter Zeitung eine Serie von Feuilletons, die kurz darauf auch in Buchform erscheint und mit ihrem Untertitel »Aus dem neuesten Deutschland«[13] anzeigt, dass sie als Analytik der Gegenwart gelesen werden will. Bereits in seinem früheren Essay über das »Ornament der Masse« hatte Kracauer eine höhere Aufmerksamkeit für die »unscheinbaren Oberflächenäußerungen« und »unbeachteten Regungen« einer Epoche gefordert, um ein »bündiges Zeugnis für die Gesamtverfassung der Zeit«[14] zu erlangen. Dem kommen die Feuilletons über die »Angestellten« nach, indem sie ein Personal in den Mittelpunkt rücken, dem die Attribute des Minderen, allzu Gewöhnlichen schon aufgrund seiner schieren Massenhaftigkeit anhaften. Dass die Angestellten als schwer zu greifende soziale Gruppe in Erscheinung treten, die vor allem der Konformismus eint, macht sie zu perfekten Repräsentanten einer allgegenwärtigen, aber unauffälligen Öffentlichkeit. Deren Strukturen, Vorlieben und Habituslenkungen müssen durch ein geduldiges Sammeln und Lesen von Indizien ermittelt werden, auf dem Weg einer Spurensuche, die sich in personeller wie sachlicher Hinsicht bei Kleinigkeiten aufhält, während sie dem (Vor-)Urteil gewichtiger Zeitzeugen misstraut.
Kracauers Feuilletons betreiben eine solche Mikrologie auf doppelte Weise, indem sie einerseits den Alltag der Angestellten durchleuchten und die Unscheinbarkeit ihres Durchschnittslebens anhand einzelner Details studieren. Andererseits schreiten sie dabei konsequent die Freiräume einer kleinen, offenen Prosaform aus, die auf strenge Systematiken so wenig festgelegt ist wie auf abschließende Synthesen. Die...