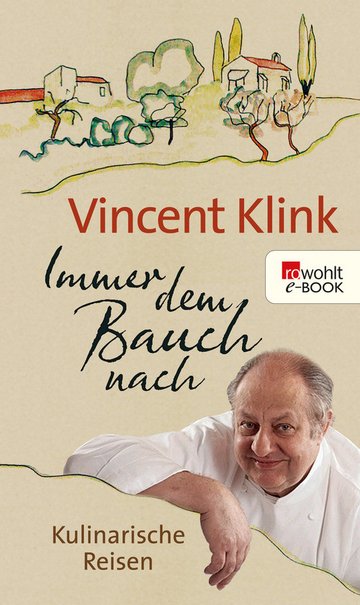Barrique im Remstal
Anfang der achtziger Jahre backte ich in meiner Küche im «Postillion» in Schwäbisch Gmünd unablässig aromaheftige Pasteten – eine Obsession, die bis heute angehalten hat. Für diese Krustenpasteten suchte ich einen Weißwein, der sich nicht beim ersten Schluck von der Pastetenscheibe begraben ließ. Kräftige, tanninreiche Weine waren damals jede Menge zu haben. Allerdings kamen die überwiegend aus Frankreich und Italien. In Deutschland hatte man Angst vor zu viel Säure und begegnete diesem Umstand gerne mit Zucker. Der herbe Nachhall, den Tannine und Gerbstoffe spenden, fand beim breiten Publikum kaum Gefallen. Dennoch benötigte die zusehends aufstrebende Küche zum Essen auch Weißweine mit dieser Art Widerstand und geschmacklicher Festigkeit. Ich beschloss, selbst solch einen Wein zu keltern, und suchte mir einen risikofreudigen Winzer dazu.
Alle meine Entscheidungen treffe ich bevorzugt mit meinem Instinkt. Neudeutsch nennt man das gerne Bauchgefühl, obwohl mein Bauch eigentlich gar nicht fühlt, sondern denkt. Ich glaube fest, dass mein Gehirn dort beheimatet ist. Naturwissenschaftlich beschlagene Leute und Anhänger des Darwinismus werden mir bestätigen, dass wir vom Einzeller abstammen. Dieser Vorfahr hatte sein Gehirn im Bauch. Damit ist er die letzten Millionen Jahre gut gefahren. Das Reich der alten Ägypter und das der Römer ist untergegangen, die Einzeller sind immer noch voll da. Und da mein Bauch ungefähr drei Millionen Mal größer ist als der Bauch dieser Tierchen, bin ich auch Millionen Mal besser beieinander.
Aus diesem Bauchgefühl heraus entschied ich mich also eines Tages anno 1983 beim Winzer Jürgen Ellwanger anzufragen. Ebenso wie ich stammt er aus dem Remstal, das von Osten kommend auf die Hauptstadt Stuttgart zuläuft. In diesem Tal leben «rechte Leut», was sie gerne auch unter Beweis stellen. Ellwanger ist von solchem Holz. Mit ihm wollte ich einen Barriquewein herstellen, also einen Wein aus dem Holzfass. Die Idee konnte eigentlich gar nicht schiefgehen, denn im französischen Wort Barrique steckt schon rein gefühlsmäßig genau die Knarzigkeit, die von diesem Winzer mit seinem wettergegerbten Gesicht ausgeht.
So zuckelte ich in meinem VW Variant von Schwäbisch Gmünd das Remstal hinab, um Ellwanger für meinen Plan zu gewinnen. Auf halbem Wege reckte sich der Turm des Klosters Lorch aus dem hohen Grün der Bäume. Jedes Mal, wenn mir dieses Gemäuer oberhalb der Ortschaft Lorch vors Auge kommt, summt es wohlig in meinem Inneren. Ich nahm die nächste Abfahrt, der Winzer konnte warten. Beherzt trieb ich den alten VW den Klosterberg hinauf. Oben angekommen, verstellte mir der Nachbau eines römischen Wachturms den Blick auf den Hohenstaufen, den Kaiserberg unweit des Tals. In meiner Kindheit hatte ich ihn auf dem täglichen Schulweg stets vor Augen gehabt. Erst als ich aus dem Schatten des Turms heraustrat, war die Sicht nach Süden frei, auch auf die beiden anderen Kaiserberge Rechberg und Stuifen. Gegen Osten konnte man fast bis Schwäbisch Gmünd sehen. Bei der Wahl des Baugrundes für die Abtei hatten die Altvordern offensichtlich ihren Sinn für magische Orte gepflegt: Ich stand auf einem Fleckchen Erde, das Kraft gibt. Und glaubt mir, Leute, ich bin kein Esoteriker. Schon die Römer wussten, warum sie gerade hier ihren Wachturm hinstellten.
Man befindet sich auf ehemals römischem Gebiet direkt unterhalb des Limes. Diese Demarkationslinie gibt mir immer wieder die schöne Illusion, mich nicht nur in südlichen Gefilden zu befinden, sondern mit meinen Vorfahren, den Hohenstaufen, sehr dem Italienischen verbunden zu sein. Lorch fungierte als Hauskloster der Staufer. Am Abhang zum Remstal ruhend, bewahrt eine gewaltige Mauer die Abtei davor, in die Tiefe zu rutschen. Diese Einfassung entlang zieht sich ein reich bestückter Klostergarten, der nichts vermissen lässt, was die mittelalterlichen Mönche an Kräutern benötigten. In kleinen Beeten findet man Rosmarin, Thymian, Fenchel, Anis und so weiter, also alles, was die Küche bis heute dermaßen befeuert, dass sich mancher Gang zum Arzt erübrigt. Denn Küche und Apotheke gehören von alters her zusammen, und beide äußern ihr Wissen durch Rezepte. So säumen sich an die Küchenkräuter, zu denen auch Liebstöckel, Schnittlauch oder Petersilie zählen, nahtlos die Heilkräuter, wie Wein- und Eberraute, Baldrian und Johanniskraut.
Über flache Steinstufen führt ein Kiesweg zur romanischen Kirche, in der Irene von Byzanz, die Schwiegertochter Kaiser Barbarossas und Patronin des Gartens, des Klosters und der Gegend, ihre letzte Ruhe gefunden hat. Diese Frau hat bis heute einen Fanclub. Dabei erlebte sie kein leichtes Dasein. In Konstantinopel als Tochter des byzantinischen Kaisers geboren, musste sie 1193 der Staatsräson wegen im Alter von nur vierzehn Jahren den sizilianischen Normannenkönig Roger III. ehelichen, der betrüblicherweise kurz nach der Heirat starb. Alsbald brachen die Staufer in die normannische Idylle ein und verschleppten die Frau als Gefangene auf die Burg Schweinhausen bei Biberach/Riss. Dort lernte sie Herzog Philipp von Schwaben kennen und lieben, den jüngsten Sohn des legendären Kaisers Friedrich Barbarossa. Es wurde geheiratet. Irene amtete nun als deutsche Königin und machte offensichtlich ihre Sache so gut, dass der Minnesänger Walther von der Vogelweide ihr Lobgesänge zueignete: «Anmutigste aller deutschen Königinnen», schwärmte der Poet in dem Gedicht «Rose ohne Dornen, Taube ohne Gallen».
Ungeachtet dessen, dass Tauben sowieso keine Galle haben (hier spricht der Koch), ging es um die Darstellung ihrer Sanftmut, die in diesen Kriegszeiten ungewöhnlich war. Der zehnjährige Bürgerkrieg zwischen Staufern und Welfen zog damals eine üble Blutspur durchs Deutsche Reich. Als das überstanden schien, fiel der Gemahl am 21. Juni 1208 in Bamberg einem Mord zum Opfer – der erste Königsmord auf deutschem Boden. Die hochschwangere Königin floh auf den Hohenstaufen. Der Rest ist schnell erzählt, Irenes lebenslange Pechsträhne kam zum Höhepunkt. Sie starb mit nur achtundzwanzig Jahren bei der Geburt ihres Kindes, und mit diesem vereint fand sie in der Klosterkirche Lorch ihre letzte Ruhe.
Es war Zeit zu gehen. Das Kloster hinter mir lassend, griff ich von einem windschiefen Apfelbaum eine rote Gewürzluike. Lange halte ich es nirgends aus, und Neugierde dürfte die stärkste Triebfeder dieser Unruhe sein. Kurzerhand schwang ich mich in mein Auto und steuerte unter dem Lärmen und hubschrauberartigen Pfeifen des luftgekühlten VW-Motors zur B 29 zurück. Auf diesem kurvenreichen Band strebte ich der Wärme des langsam tiefer und breiter sich weitenden Tals entgegen. Immer auf diesen Wegen kommt es mir vor, als hellte sich der Himmel auf. Es mag daran liegen, dass nun bald die Klimazone des Weinbaus beginnt. Keine Frage, wo Wein wächst, da kann man sich getrost niederlassen. Nichts gegen meine Heimatstadt Schwäbisch Gmünd, die im oberen Tal, also dem kälteren Abschnitt siedelt. Sie hat mich wie nichts anderes geprägt, und einen Großteil meines frohen Wesens verdanke ich ihr. Aber hier im unteren Tal addiert sich zum Heimatgefühl noch etwas anderes: Die Landschaft ist lieblicher, und die Ergebnisse des Weinbaus sind für mich gelebter und wohlig einzuverleibender Humanismus.
Dort ist gut sein, und als ich schließlich in Winterbach beim Weingut Ellwanger eintraf, machte sich eine gewisse Euphorie breit. Meine Turnschuhe knirschten über den Hof. Der Winzer, ein echter schwäbischer Schaffer, begrüßte mich, wir kannten uns bereits. Als er mir die Hand gab, schrammte ich mir an seinen Pfoten fast meine küchendampfverwöhnten Hände auf. Ich hatte ihn bereits vorgewarnt, jetzt wurde ich konkret: «Jürgen, du machsch einen sauguten Wein. I denk, dass du dich mal an einem Barriquewein versuchen solltest.» Jürgen, in seiner bedächtigen Art, ließ sich viel Zeit mit der Antwort. Leise zögernd, ja fast im Rückwärtsgang erwiderte er: «Also, Vincent, des macht man eigentlich nur mit Rotwein. Allerdings, der Franz Keller hat jetzt auch beim Weißwein diese Franzosenmethode angewandt.» Keller, der berühmte Gastronom und Winzer vom «Schwarzen Adler» – eines meiner Vorbilder –, hatte als Erster deutsche Weine in Barriquefässer gelegt. Jürgen hielt inne und fuhr dann aber mit festerer Stimme fort: «Ha, wir könnten mal ein Fässle ausprobiere, auch wenn’s schiefgeht, wird das bestimmt kein Flurschaden.»
Ich war ja noch ein junger Spund und geriet in freudiges Hüpfen. «Also, wo kriegt man so ein Fass her?» Jürgen befahl mir, auf die Schwäbische Alb nach Mössingen zu fahren und dort beim Fassmacher Schanz so einen «Holzhurgel» zu holen. Nach vierzehn Tagen war das Fass aus schwäbischer Eiche zusammengesetzt. Ich lenkte meinen VW-Kombi wieder nach Mössingen und lud das Prachtstück ein, für das dem Fassmacher ungefähr dreihundert Mark in die Hand gedrückt wurden.
Das Schicksal nahm seinen Lauf. Wir wählten für unser Experiment die damals stets etwas fett ausgebaute Ruländertraube, um dieser dann mit den Holzaromen zu mehr Struktur und Fundament zu verhelfen. Der rachitisch-dünne Jahrgang 1984 kam zur Ernte und war schnell eingefüllt. Erste Fassproben des Grauburgunders erinnerten an Salzsäure und schlugen Jürgen und mir schwer aufs Gemüt. Also ließen wir ihn einfach im Fass weiterreifen und dachten «Der wird scho». Wir hatten ja schließlich völliges Neuland betreten, und Neues sowie Optimismus sind bekanntlich eng verschwistert. Genau so war es dann auch. Das Eichenholz lieferte jede Menge der von mir gewünschten Tannine, und die Reifung tat aufs prächtigste das Ihre. Dieses...