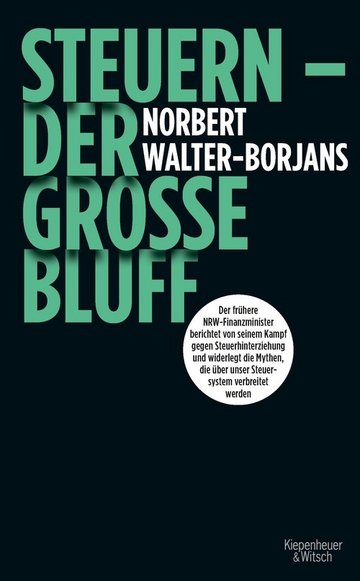InhaltsverzeichnisI. Warum wir handeln müssen
1. Etwas läuft schief in Deutschland
Umfragen zufolge sind die Deutschen in der Mehrheit zufrieden mit den Verhältnissen im Land. Die eigene wirtschaftliche Lage finden die meisten gut oder sehr gut. Zumindest sagen das seit Jahrzehnten rund zwei Drittel der Befragten. Es gab aber auch immer das andere Drittel, das diese Einschätzung für sich selbst nicht teilen konnte. Demgegenüber schätzten die Menschen im Land die allgemeine Lage lange Zeit verhaltener ein als die eigene. Darin drückte sich gleichsam eine Art Mitgefühl aus. Man spürte, dass es noch andere gab, denen es schlechter ging.Es herrscht eine Hochstimmung im Land, die die Sorgen der Minderheit übertönt
Das hat sich seit einigen Jahren geändert. Die Deutschen sind mittlerweile mit überwältigender Mehrheit davon überzeugt, dass es nicht nur für sie selbst, sondern auch insgesamt gut läuft in Deutschland.
Ist das ein Wunder bei Gewinnrekorden der Wirtschaft, Minusrekorden bei der Arbeitslosigkeit und Rekordsteuereinnahmen? Bestätigen nicht auch die Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts ebenso wie die des Privatvermögens den grundsoliden Lebensstandard in Deutschland – zumal, wenn wir gleichzeitig von den Krisen in anderen Ländern erfahren? Zeigt uns das alles nicht, wie gut es uns in Deutschland geht? Kann man vor so einer Kulisse ernsthaft über Gerechtigkeitsdefizite reden? Und gibt es überhaupt noch ein Wir-Gefühl, an das man appellieren könnte, oder ist unsere Gesellschaft inzwischen auf ein Gruppendenken reduziert, in dem das »Gemeinwesen als Ganzes« weit in den Hintergrund getreten ist? Demoskopische Analysen legen den Schluss nahe. Deshalb gibt es – auch in den eigenen Reihen – nicht wenige, die einem nach Wahlen mit einem wenig zufriedenstellenden Ausgang für die SPD auf die Schulter klopfen und sagen: »Man kann in dieser guten Gesamtstimmung nun mal mit dem Thema ›soziale Gerechtigkeit‹ allein keine Wahlen gewinnen.«
Allein mit der Forderung nach Gerechtigkeit gewinnt man in der Tat keine Wahlen. Das behauptet aber auch niemand ernsthaft. Die Menschen wissen, dass die Welt nicht besser wird, wenn man versucht, sie anzuhalten, und sich nur noch auf die Umverteilung des Erreichten konzentriert. Der Aufbruch zu neuen Ufern gelingt aber am besten, wenn die Menschen wissen, dass die Gemeinschaft sie hält, dass sie eine kalkulierbare Zukunft haben und dass es gerecht zugeht. Dazu gehört die alte Lebensweisheit jeder funktionierenden Gemeinschaft, dass starke Schultern mehr tragen müssen als schwache. Auch finanziell.
Die auf der Sonnenseite weisen in diesem Zusammenhang gern darauf hin, dass auch für die sogenannten kleinen Leute mehr herauszuholen sei, wenn man es den Großen nicht abnehme, sondern stattdessen für Wachstum sorge. Dann könne man den einen etwas geben, ohne es den anderen zu nehmen. Klingt überzeugend. Aber so läuft es in Wirklichkeit nicht. Seit Jahren brummt die Wirtschaft, seit Jahren wächst das private Geld- und Sachvermögen, seit Jahren steigen die Durchschnittseinkommen, aber das alles hat nicht dazu beigetragen, dass sich die Schere in der Einkommens- und Vermögensverteilung schließt. Im Gegenteil: Der Abstand zwischen oben und unten ist gewachsen. Nicht nur, weil die Top-Verdiener mehr vom Zuwachs erhalten als die Kleinverdiener. Die kleinen Einkommen sind real sogar gefallen. Die Kleinen haben an die Großen abgegeben. Umverteilung von unten nach oben nennt man das.
*
Außerdem sind oben und unten zunehmend getrennte Welten. Und es sieht nicht danach aus, dass sich die Kluft von selber schließen würde. Auch nicht in Zeiten guter Konjunktur und explodierender Gewinne. Die gern erhobene Behauptung, dass es jede und jeder bei uns schaffen kann, wenn er oder sie nur will, ist ein Märchen. Wer in einem Hartz-IV-Haushalt aufwächst, hat nur geringe Chancen, einmal frei von finanziellen Sorgen leben zu können. Wer oben dazugehört, hat mehr als nur bessere Ausgangsvoraussetzungen. Im Zweifel kann er oder sie sogar mit einer hohen Erbschaft oder einer vorgezogenen Schenkung rechnen.
Auch die Mittelschicht selbst ist gespalten. Vieles erinnert an ein gigantisches Radrennen. Die im vorderen Mittelfeld hecheln dem Ideal hinterher, einmal ganz vorn dazuzugehören. Das Interesse, sich hin und wieder umzudrehen und die mitzunehmen, die sich weiter hinten abstrampeln, hält sich im Pulk zwischen den Ausreißern ganz vorn und denjenigen hinten, die den Anschluss verloren haben, in Grenzen. Einen großen Teil des Mittelfeldes treibt aber auch die Sorge um, trotz größter Anstrengung irgendwann nicht mehr mithalten zu können und ans Ende durchgereicht zu werden. Viele denken darüber nach, was sein wird, wenn sie älter werden oder wenn es aus anderen Gründen einmal nicht mehr so glattläuft.Statt für Ausgleich zu sorgen, hat das Wachstum die Spaltung vertieft
Das alles hat zu einer Entfremdung der gesellschaftlichen Schichten geführt. Damit sinkt auch die Bereitschaft, einen finanziellen Beitrag für das Gemeinwesen als Ganzes zu leisten. Die Sozialwissenschaftler sprechen vom Milieu-Egoismus. Ein Wir-Gefühl gibt es höchstens innerhalb ein und derselben sozialen Schicht. Wie bei den Teams der Tour de France. Wenn überhaupt. Langsam, aber sicher zieht sich das Gesamtfeld immer weiter auseinander. Im wahren Leben ist das allerdings folgenschwerer als bei einem Radrennen.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und der Internationale Währungsfonds (IWF) haben die wachsende Kluft zwischen oben und unten mit Zahlen belegt. Seit 1991 vergrößert sich die Spreizung in der Einkommensentwicklung fast von Jahr zu Jahr. Anders als das Mantra, dass man nur Wachstum brauche, um die kleinen Einkommen ohne Belastung der großen nach und nach besserzustellen und den Abstand zu verkleinern, belegt besonders die seit der Finanzkrise anhaltend gute Konjunktur das Gegenteil. Ein Gutverdiener am Beginn des oberen Zehntels der Einkommensskala hatte 2015 rund 30,8 Prozent mehr an verfügbarem Einkommen als 1991. Haushalte mit mittlerem Einkommen standen um 8 Prozent besser da, Kleinverdienerhaushalte im unteren Zehntel treten dagegen nicht einmal auf der Stelle. Sie haben im Aufschwung rund 10 Prozent eingebüßt. Und nach der Finanzkrise 2009, also in der Phase des stabilsten Wachstums, hat sich die Schere keineswegs geschlossen.
*
Abb. 1 Veränderung des verfügbaren Haushaltseinkommens gegenüber 1991 Quelle: DIW
Die Statistik zeichnet nur nach, was wir trotz bester Wirtschaftsdaten inzwischen regelmäßig in der Zeitung lesen. Es ist die Konsequenz aus dem hinreichend widerlegten Glauben, die Maximierung des betriebswirtschaftlichen Erfolgs durch jedes einzelne Unternehmen sei automatisch das Beste für alle. Wie sollen die Menschen das glauben, wenn zum Beispiel Siemens 2017 trotz sprudelnder Unternehmensgewinne ankündigte, Tausende von Arbeitsplätzen abzubauen, noch dazu in strukturschwachen Regionen? Andere Global Player machen es genauso. Je globaler, desto anonymer; je anonymer, desto stärker fokussiert auf die Rendite als einzigem Erfolgsmaßstab. Für ein Unternehmensverständnis, Teil eines großen Ganzen zu sein, ist in diesem Wettlauf kein Platz. »Soziale« Marktwirtschaft ist das nicht. Eher eine entfesselte.Je globaler, desto anonymer; je anonymer, desto stärker fokussiert auf die Rendite
In dieser entfesselten Marktwirtschaft sind Steuern nicht etwa ein Beitrag, um die Voraussetzungen für den zukünftigen Unternehmenserfolg zu schaffen. Steuern senken nach dieser Lesart lediglich die kurzfristige Rendite. Deshalb gilt es, sie mit allen Mitteln zu vermeiden.
Ohne Wettbewerbsfähigkeit gibt es keine Arbeitsplätze, und Wettbewerbsfähigkeit bedeutet nun einmal, keine Belastungen tragen zu müssen, die es anderswo nicht gibt. Das gilt für die Höhe der Löhne ebenso wie für die staatlichen Abgaben. Die politischen und sozialen Verwerfungen, die durch das Gegeneinander-Ausspielen von Staaten verursacht werden, werden geflissentlich verdrängt. Die Wahrnehmung unternehmerischer Verantwortung für Standorte und Beschäftigte endet da, wo gute zweistellige Renditen gefährdet sind. »Rentabilitätsextremismus« nennt der Wirtschaftsethiker Ulrich Thielemann die Ausrichtung auf nur noch eine Kenngröße wirtschaftlichen Erfolgs.[1]
Sparer müssen indessen mit Nullzinsen über die Runden kommen. Wenn es denn überhaupt Ersparnisse gibt. Für die meisten Kleinverdiener bleibt nämlich nichts übrig, das sie auf die hohe Kante legen könnten. Im Gegenteil: Sie »entsparen«. Das heißt: Solange noch Restvermögen da ist, leben diese Haushalte von der Substanz, wenn nicht, bleibt nur der Weg in die private Verschuldung. Ersparnisse sind erst bei mittleren Einkommen möglich, und auch da in meistens sehr bescheidenem Umfang. Auf welche Einkommensgruppe sich das rasant wachsende Geldvermögen der Deutschen von zurzeit fast 6 Billionen Euro konzentriert, ist also nicht schwer zu erraten: auf die ganz oben im Reichtums-Ranking. Währenddessen gelten über 20 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Geringverdiener mit einem Stundenlohn unter 9,60 Euro. Zwei Millionen Kinder leben von Hartz IV. Für 16 Prozent der...