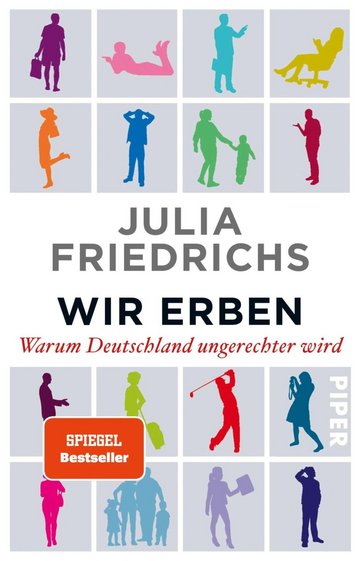1. FUCKING HELL –
WIR HABEN EINFACH NUR GLÜCK
Etwas muss ich noch erledigen, bevor es tatsächlich losgehen kann: Ich muss das Medley, das seit meinen Lesewochen in meinem Kopf spielt, zum Schweigen bringen. All die Zahlen, die von großer Ungerechtigkeit erzählen, beiseitelegen. All die Zitate, die eine tiefe Kluft der Gesellschaft beschwören, erst mal vergessen. Denn ich glaube: Mit solch grobem Strich ließe sich kein Bild der neuen Erbengeneration zeichnen. Hier die reichen Nachkommen, dort die armen Habenichtse, hier die satten Abkömmlinge, dort die hungrigen Emporkömmlinge, hier die per Geburt Glücklichen, dort die von Beginn an Abgehängten. Das ist zu simpel, die moderne Gesellschaft zu divers, zu zerfasert, zu kompliziert. Will man der Wirklichkeit gerecht werden, müsste man versuchen, ein Mosaik zu legen – zusammengesetzt aus Hunderten Steinchen, geformt aus Dutzenden Geschichten, Wahrheiten und Widersprüchen.
Das erste Steinchen soll Lars sein. 41 Jahre alt. Komponist.
Lars redet. Atemlos. Seit eineinhalb Stunden. Seit die Tür hinter uns ins Schloss gefallen ist. Er hatte mich kurz durch seine neue Wohnung geführt. 165 Quadratmeter, ein Prachtstück. Perfekt sah sie aus, Wohnzeitschriftenatmosphäre, auch wenn ein Großteil der Möbel von IKEA war. Am Eingang hing eine Kreidetafel mit den Namen und Terminen der drei Kinder. Dahinter: eine offene Wohnküche, in der die älteste Tochter, ein Teenager mit langem blonden Haar, an einem gemütlichen Holztisch saß. Direkt daneben dann das helle Wohnzimmer, im Mittelpunkt: ein riesiges Sofa, schick, aber schlicht. Darauf lag das mittlere Kind, der Sohn, gerade etwas bockig. Vom langen Flur zweigten die Zimmer ab: drei Kinderzimmer – ganz hinten das der Jüngsten, die gerade Besuch hatte und nicht gestört werden wollte –, das Schlafzimmer und Lars' Büro. Hier hatte er eine zweite Ebene einziehen lassen, die gemauerte Decke und die Rundbögen des Backsteinbaus waren freigelegt und alte Türen aus einem Bauelementelager eingesetzt. »Unsere Angst war, dass es zu sehr nach Neubau aussieht«, hatte Lars gesagt.
Lars ist freier Komponist. Anfang vierzig, aber er sieht jünger aus, ein hübscher Typ mit blondem Haar und breitem Lachen. Nach seinem Studium hatte er einen guten Start – er konnte eine Filmmusik bei Arte platzieren, wurde zu einem Nachwuchsfestival eingeladen –, aber in den Jahren danach lief es lange ziemlich schleppend. Fernsehmusik, Kinomelodien, sogar Opern – er hat viel entwickelt, angedacht, geschrieben. Aber es hat gedauert, bis er die Ergebnisse auch verkaufen konnte. Inzwischen geht es aufwärts. Doch das große Geld hat Lars in seinem Job noch nicht verdient. Seine Frau unterrichtet an einer Musikschule.
Ihre Wohnung hat rund 3000 Euro pro Quadratmeter gekostet, insgesamt fast eine halbe Million Euro. Sie hätten sich diese Wohnung niemals leisten können – wenn es Lars' Vater nicht gäbe. Oder noch präziser: sein Geld. Das große Geschenk. Das vorgezogene Erbe.
Die Winterdämmerung verhüllt den Kanal, auf den wir zulaufen. In unserem Rücken schimmern die beleuchteten Fenster von Lars' Wohnung. Sie liegt in einer parkähnlichen Anlage aus dem späten 19. Jahrhundert, die neunzehn denkmalgeschützten Häuser, typische Berliner Klinkerbauten mit gelber Ziegelfassade, werden von einem Zaun, an einigen Stellen von einer Mauer umfasst. Die Mehrheit der Bewohner hätte die Abgrenzung am liebsten niedergerissen, aber das Denkmalamt ließ nicht mit sich reden. Nun müsse man sich ständig gegen das Vorurteil verteidigen, man wolle sich hier einmauern, sagt Lars. Früher war auf dem Gelände eine psychiatrische Tagesklinik untergebracht. Aber vor sechs Jahren bot der stadteigene Krankenhauskonzern die Anlage zum Verkauf an. Eine Baugruppe griff zu, investierte rund 45 Millionen Euro. Es entstanden 136 Wohnungen und Reihenhäuser, bewohnt von einem, wie Lars sagt, »eher linksliberalen Bürgertum«, Grünen-Klientel, viele kreative Leute, auch Juristen und Selbständige.
»Es waren Familien, für die – wie für uns auch – auf dem Mietmarkt in Kreuzberg das Ende der Fahnenstange war«, sagt Lars. »Wir wollten Strukturen schaffen, in denen wir uns sicher fühlen – mit drei Kindern in dieser irren Welt.«
Es ist ein behagliches Nest geworden. Durch die Scheiben einer der Wohnungen sehe ich hohe, glatt verputzte Wände mit meterhohen Bücherregalen, daneben bunte Kinderzeichnungen. Einer der Bewohner hat eine siebenstöckige Weihnachtspyramide ins Fenster gestellt. Langsam drehen sich die Flügel über den Flammen der Kerzen.
Im Sommer sieht es in der Siedlung aus wie in einem postmodernen Bullerbü: Eine Handvoll Kinder spielt Fußball auf einer der Gemeinschaftswiesen. Drei Mädchen hüpfen auf einem Trampolin. Ein Kleinkind rollt auf seinem Rädchen noch etwas wackelig über den Weg, der die Häuser verbindet. »Es ist schon ein kleines Utopia«, sagt Lars.
Es ist schön hier. Es ist das, was alle wollen. Es ist das, was hier nur noch wenige bekommen können. Um zwölf Prozent sind die Preise in diesem Bezirk Berlins im vergangenen Jahr gestiegen. Wer nicht kauft, muss Quadratmeterpreise zahlen, die bis zu 40 Prozent über dem Mietspiegel liegen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung vermutet, dass in den Großstädten die Mieten auch in Zukunft in ähnlichem Tempo weiter anziehen werden, nämlich im Schnitt um acht Prozent pro Jahr.
Lars sagt, er kenne inzwischen diesen Blick in den Augen seiner Freunde, wenn er sie durch die Räume führt. Ich bin sicher, dass auch ich vorhin so schaute: ein bisschen unentspannt, ein bisschen angestrengt. Neidisch eben. »Ich kann damit nicht umgehen«, sagt Lars. »Ich weiß nicht, wie ich mich zu der Wohnung verhalten soll. Ich stelle mich natürlich nicht hin und sage: Oh, schaut her, mein Besitz. Ich versuche es kleinzureden, schäme mich. Und dann finde ich diesen verdrucksten Umgang auch wieder verlogen.«
Besonders verkrampft, sagt Lars, ist der Umgang mit einer Familie, die er zu seinen engsten Freunden zählte. Sie lernten sich in der Krabbelgruppe ihrer ältesten Töchter kennen und segelten seitdem wie Zwillingsyachten durchs Leben. So schien es zumindest. Ihre Familien wurden zeitgleich größer, die Kinder wurden Freunde. Sie fuhren alle zusammen in den Urlaub, sie hatten dieselben Sorgen. »Und jetzt sitzen die Freunde in meiner Küche und erzählen davon, dass ihre Wohnung zu klein wird, dass sie für ihren Ältesten kein eigenes Zimmer haben; dass sie jetzt so kleine Kajüten in die Wände bauen, um den Kindern zumindest ein bisschen Privatsphäre zu schaffen. Und ich sitze denen gegenüber und fühle mich total bescheuert, weil ich weiß: Ich habe es nicht verdient. Ich habe dieses Geld im wahrsten Sinne des Wortes nicht verdient.« Aber reden, sagt Lars, kann er über all das mit seinen Freunden nicht.
Ich frage: »Und jetzt? Macht es dir nichts aus, davon zu erzählen?«
Er sagt: »Ich glaube, ein bisschen ist das jetzt auch ein therapeutisches Gespräch. Ich muss mein Verhältnis zu diesem Geld klären.«
Dann redet er über all das, worüber meine Freunde schweigen, über all das, worüber auch er mit seinen Freunden nie sprechen könnte: über sein Leben als Erbe. Schnell wird klar: Die schicke Wohnung ist nur das offensichtliche Symptom, das, was jedem sofort ins Auge springt. Aber es gibt, sagt Lars, noch vieles mehr, das ihn von den anderen, den Nichterben, trennt. Sein Leben wird gehalten von einem schützenden Netz, einem Netz, das niemand sieht, gewebt aus dem Geld seines Vaters.
»Das Wissen darum hat mir vieles ermöglicht«, sagt er. »Hätte ich einen Beruf gewählt, der mit solch einer Unsicherheit verbunden ist wie freiberufliches Komponistendasein, wenn ich nicht im Hinterkopf das Gefühl gehabt hätte, da ist noch ein Sicherungsnetz?« Er hält inne. »Ganz im Ernst«, sagt er. »Das geht noch weiter. Das fängt schon damit an, dass wir unsere erste Tochter zu diesem Zeitpunkt wohl kaum bekommen hätten.«
Cut. Rücksprung.
Lars ist 27, Student der Musikwissenschaften. Er hat Ambitionen, will nach Berlin, will zum Film, will Melodien erfinden, nicht nur darüber reden, wie so viele Musiktheoretiker – Wissenschaftler, die nach dem dritten Bier plötzlich erzählen: »Ja, ja, ich habe auch noch eine Partitur in der Schublade.« Seine Frau, die damals noch seine Freundin war, ist noch in der Ausbildung. Die beiden reisen nach Italien. Es geht ihnen gut zusammen. Und schon bald nach ihrer Rückkehr stellen sie fest, dass sie Eltern werden. »Meine Frau war völlig schockiert«, sagt Lars. »Keiner um uns herum hatte Kinder.« Lars aber nahm die Nachricht gelassen entgegen. »Ich fand das super«, sagt er. »Ich wusste, wir schaffen das. Und dieses Gefühl hing damit zusammen, dass mir mein Vater zwei, drei Jahre vorher völlig ungefragt einen Kontoauszug gezeigt hatte.« Einen Kontoauszug, der Lars klarmachte, wie viel sein Vater für ihn angelegt hatte.
Das erste Kind, die Tochter, wird geboren. Lars zieht mit seiner kleinen Familie nach Berlin, nach Kreuzberg, wo er immer hinwollte. Er macht eine Ausbildung bei einer Firma, die vor allem Musik für Werbespots produziert. Er hätte bleiben können, Geld verdienen. Aber er merkt, dass die Werbung nicht so seins ist, wie er sagt. Er denkt an seinen alten Traum vom großen Film und bewirbt sich für ein Masterstudium an der Musikhochschule. Er wird angenommen. Während seines Studiums wird seine Frau wieder schwanger. Mit dem Sohn sind sie nun zu viert. Trotzdem sucht Lars sich nach dem Studium nicht irgendeine Stelle, sondern versucht sich als Komponist...