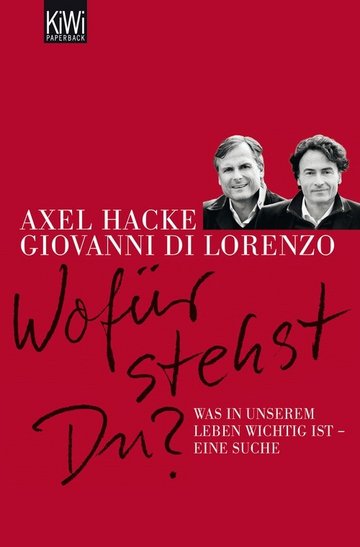Meine Leidenschaft für Politik
oder
Wie es kommt, dass ich mich manchmal wie ein kleines Arschloch fühle
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man an Politik nicht interessiert sein kann. Bei mir begann dieses Interesse, als ich ein kleiner Junge war. Lag das an besonderen Einflüsterungen meiner Familie? Oder an der Zeit, in die ich hineingeboren wurde?
Als ich klein war, protestierten fast überall in Europa die Studenten auf den Straßen, und in Vietnam führten die Amerikaner Krieg. Meine Eltern diskutierten bei jeder Gelegenheit über diese Themen, es waren aufregende Zeiten, zu aufregend für einen Neunjährigen, wie sie fanden. Sie erlaubten nicht, dass ich Zeitung las; ein Fernseher wurde gar nicht erst angeschafft.
Das machte das Weltgeschehen für mich natürlich noch interessanter, als es ohnehin schon war. Und ich fand einen Weg, fast jeden Tag Zeitung zu lesen, schon als Drittklässler.
Mein Vater kaufte, als wir in Rimini lebten, ein Blatt namens Il resto del carlino. (Der Name stammt aus einer anderen Zeit: Der carlino war einst eine Münze, die niemand mehr kennt, il resto war der Rest dieser Münze. Das Blatt kostete also ursprünglich offenbar nicht mehr als das Wechselgeld.) Das Mietshaus, in dem wir damals wohnten, war das letzte an einer längeren Straße, die direkt zum Strand führte. Der Blick von meinem Zimmer im vierten Stock war unverbaut, ich lag oft viele Stunden am Tag oben auf einem Etagenbett und schaute aufs Meer, ein Blick, der mich zugleich beruhigte und langweilte.
Zum Zeitungsladen waren es vielleicht zweihundert Meter stadteinwärts, und mein Trick, doch irgendwie zum Zeitunglesen zu kommen, bestand darin, dem Vater anzubieten, ihm morgens den Resto del carlino vom Kiosk zu holen, wie das in Italien üblich ist: Jeder kauft sich dort seine Zeitung am Kiosk, weil die Post oder jedes andere Zustellverfahren viel zu unzuverlässig wären.
Manchmal, wenn der Wind das zuließ und es nicht zu heiß war, setzte ich mich zur Lektüre gleich auf das Mäuerchen an der Strandpromenade. Meistens jedoch las ich im Wohnzimmer, während mein Vater im Bad mit der Rasur und schier endlosen morgendlichen Waschungen beschäftigt war. Trat er dann aus dem Bad, legte ich die Zeitung rasch sorgfältig wieder zusammen. Er sollte ja das Gefühl haben, ein noch ungelesenes Blatt zur Hand zu nehmen.
Meine große Sorge als kleiner Junge war, dass die Amerikaner in Vietnam verlieren könnten. Ich hielt zu den Amerikanern, wie man zu einer Fußballmannschaft hält, und zählte Tag für Tag aufgrund der Angaben im Resto del carlino die Opfer beider Seiten zusammen, was mir zunächst das Gefühl gab, dass Südvietnamesen und Amerikaner die Oberhand behielten. Ein trügerisches Gefühl, wie sich herausstellen sollte.
Der erste Politiker, den ich kennenlernte, war mein Großvater, der in einem Dorf in der Nähe von Braunschweig lebte. Er war Handelsvertreter von Beruf, später besaß er ein Möbelgeschäft. Weil er viel unterwegs sein musste, hatte er schon sehr früh ein Auto. Eines Tages hatte er mit diesem Auto einen Unfall, bei dem er sich das Knie schwer verletzte. Seitdem ging er am Stock.
Nach dem Krieg baute mein Großvater ein Haus, in dem ich während meiner ersten Lebensjahre zusammen mit meinen Eltern lebte. Viele Jahre lang war er dann Bürgermeister dieses Dorfes, als Sozialdemokrat, weshalb für mich, da auch mein Vater nie etwas anderes als SPD wählte, als Kind keine andere Partei als die SPD akzeptabel erschien.
Nachmittags spazierte mein Großvater mit einem Dackel namens Waldmann an der Leine durch den Ort. Er war eine Erscheinung von großer Autorität: immer in einem grauen Anzug mit Weste, Krawatte und goldener Uhrkette, das Haar straff zurückgekämmt und schlohweiß wie der Schnauzbart, würdevoll wie alle seine Brüder, meine Großonkels. Kaum je sah ich meinen Großonkel Willi, der Schlosser war und Mitglied der IG Metall, meinen Großonkel Otto, der den Krieg als Holzfäller in Finnland überlebt hatte, meinen Großonkel Walter, meinen Großonkel Kurt oder einen anderen aus der unübersehbar großen Großonkelmenge anders als in Anzügen mit Weste und Krawatte.
Wenn ich als kleiner Junge gemeinsam mit dem Sohn des Bäckers und dem des Feuerwehr-Kommandanten das Wasser im Dorfgraben aufstaute, um Schiffchen fahren zu lassen, zeigte der Großvater mit seinem Gehstock auf den Staudamm und sagte, das müssten wir nachher aber wieder wegmachen. Wir gehorchten. Nicht zu tun, was er angeordnet hatte, kam nicht infrage.
Jedenfalls nicht für uns Kinder.
Andere widersetzten sich ihm sehr wohl. Der Großvater besaß einen Kirschbaum, direkt vor seinem Haus. Und in jedem Winter träumte er davon, im Sommer Kirschen von diesem Baum zu essen, er schwärmte von den Früchten dieses Baumes, von frischen Kirschen, von Kirschkuchen mit Schlagsahne und eingelegten Kirschen im Glas.
Und in jedem Sommer, wenn sich die ersten Kirschen am Baum röteten, erschien am Himmel ein Schwarm von Staren, ließ sich auf den Ästen nieder und fraß, was der Baum hergab.
»Die verdammten Stare! Die Stare!«, schrie mein Großvater, rannte ins Haus, holte sein Gewehr und schoss in den Baum, während die Großmutter uns Kinder eilig beiseitezog und die Stare halb höhnisch, halb erschreckt kreischend aufflatterten, den Baum leer und den Großvater in ohnmächtigem Zorn zurücklassend.
Er war ein cholerischer, kraftvoller, energischer, autoritärer Mann, mein Großvater, aber er war mir auch fern, ganz anders als meine Großmutter, die mich behandelte, als sei ich ein spät geborener Ersatz für ihren ältesten Sohn, meinen Onkel, der gegen Ende des Krieges in einem Krankenhaus unserer Heimatstadt gestorben war. Irgendwie muss sie immer Angst gehabt haben, auch ich könnte verschwinden. Deshalb mästete sie mich regelrecht. Jedes Mal, wenn ich sie besuchte, machte die Großmutter mir sofort etwas zu essen, egal, was ich sagte, auch wenn ich gerade vom Essen kam – ich musste essen bei ihr, und ich tat es, ihr zuliebe.
Noch viel mehr als über die Kirschendiebe erregte sich mein Großvater indes über den Oppositionsführer im Gemeinderat, er hieß Schubmann und gehörte der CDU an. Oft hörte ich ihn, wenn er von einer Sitzung zurückkehrte, laut und wütend »dieser Schubmann!« rufen und meiner Großmutter Vorträge halten, welchen Unsinn »dieser Schubmann!« wieder einmal geredet habe.
Eines Tages fiel mein Großvater auf dem Heimweg vom Gemeinderat vor dem Haus tot um. Nicht auszuschließen, dass seine letzten Worte mit Schubmann zu tun hatten.
Vielleicht identifizierte ich mich damals mehr mit meinem italienischen Großvater als mit meinem Vater. Der Großvater war Wollfabrikant und ein Patriarch wie aus dem vorvorletzten Jahrhundert: Brillantine im rabenschwarzen Haar, schwarzer Nadelstreifenanzug, schwarz-weiße Schuhe, aufbrausend, aber mit einem Herz so groß wie der Eingang zum Grand Hôtel von Rimini, das in der Nähe seiner kleinen Fabrik lag.
Schon zu Lebzeiten umrankten ihn Mythen, wie die Geschichte vom sagenhaft azurblauen Bugatti, den Großvater bis zum Ausbruch des Krieges fuhr. Es war ein besonders seltenes Modell, von dem es in Italien nur sechs bis zehn Stück gegeben haben soll. Als die von Verbündeten zu Kriegsgegnern gewordenen Deutschen in Richtung Rimini vorrückten, ließ mein Großvater das gute Stück im Haus eines Bauern einmauern. Doch die Deutschen entdeckten das Auto, vielleicht hatte auch jemand gepetzt. Mein Großvater jedenfalls sah den Bugatti nie wieder.
Für ihn gab es nichts Schöneres, als seine Familie und Freunde zum Essen einzuladen. Er ließ es sich selten nehmen, persönlich den Einkauf zu erledigen, und kaufte riesige Mengen an Obst, Fleisch oder Fisch. Die reichten damals, als noch kein Mensch irgendeine Diät kannte, gerade für ein größeres Abendessen. Wenn alles verspeist war, ging mein dicker Opa manchmal noch fröhlich in die Küche und kochte für alle Spaghetti aglio, olio e peperoncino.
Der Großvater hatte eine Sekretärin namens Natalia, die ihm eines Tages aufgewühlt von ihrem Freund erzählte. Ich belauschte das Gespräch vom Verkaufsraum seines Wollgeschäftes aus: Der Freund studierte in Rom und hatte offenbar Ärger bekommen mit dem Rektorat, der Polizei oder der Justiz – oder mit allen dreien. Jedenfalls brachte mein Opa sein Unverständnis gegenüber diesem Protestler zum Ausdruck, während Natalia versuchte, sein Verständnis zu wecken.
Der Protestler war »links«, womöglich Kommunist, mein Opa war Fabrikbesitzer und fühlte sich von ihm bedroht, die Gegner der Amerikaner in Vietnam waren ebenfalls Kommunisten. So verliefen die Fronten, so sah die Welt für mich als Kind aus.
Und für einen Moment geriet diese Welt für mich aus den Fugen. Selbst mein Großvater schien schon in Gefahr zu sein! Ich ging zu meiner Mutter und sagte traurig (die Lage in Vietnam hatte sich nun auch in meiner Wahrnehmung verändert): »Überall gewinnen die Linken.« Doch meine Mutter lachte nur und sagte: »Jeder intelligente Mensch ist doch heute links!«
Vielleicht wirkte Großvaters Gespräch mit seiner Sekretärin auf mich auch deshalb so bedrohlich, weil ich damals schon eine andere Großvatergeschichte kannte, die mein Vater gut zwanzig Jahre vorher erlebt hatte, auch er als Kind.
Es war das Jahr 1948. Das vom Faschismus befreite Italien wählte sein erstes Parlament, und es schien möglich, dass die...