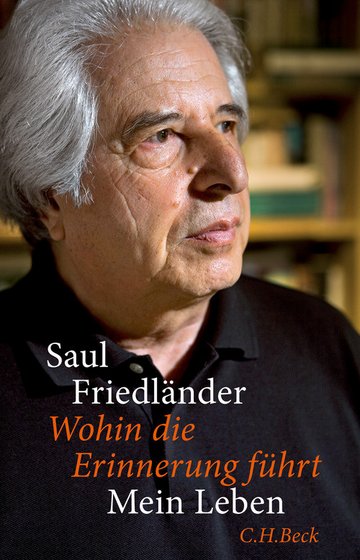SIEBTES KAPITEL
Die nahenden Schritte des Messias
Aus jedem Fenster, auf jeder Terrasse, in allen Kaffeehäusern schmetterten die Radios Uri Zohars «Nasser mechakeh le Rabin, ai, ai, ai …» (Nasser wartet auf Rabin, ai, ai, ai), oder sie brachten die elegischen Klänge von Naomi Schemers «Jeruschalajim schel Sahav…» (Jerusalem aus Gold …). Es war ein Rausch, ein Ausbruch grenzenlosen nationalistischen Hochgefühls.
Vieles davon war die spontane Reaktion auf ein zwei Wochen langes Warten voll banger Vorahnungen und auf den überwältigenden Sieg, der dann folgte. Unter dem zögerlichen Premierminister Eschkol, dafür aber mit Dajan als neu ernanntem Verteidigungsminister in einem Kabinett der nationalen Einheit, hatte Israel zugeschlagen. Innerhalb von sechs Tagen besetzte der jüdische Staat die Halbinsel Sinai, die West Bank des Jordan (da König Hussein sich der anti-israelischen Koalition angeschlossen hatte) und die syrischen Golanhöhen oberhalb des Sees Genezareth; vor allem eroberte er ganz Jerusalem. Manche Israelis meinten schon, die Schritte des Messias nahen zu hören.
Der Gegensatz zwischen dem diskreten Genf und diesem Überschwang war nervenaufreibend, aber so sehr mir der nationalistische Jubel gegen den Strich ging, so sehr erschien mir doch damals Israels politischer Kurs vernünftig zu sein. Ich hatte gerade auf einer Konferenz in Genf mit einem hitzigen und wortgewaltigen israelkritischen Professor aus Princeton diskutiert, Arno Mayer. Und ein paar Tage nach Ende des Krieges kam es zu einer «denkwürdigen» Konfrontation, diesmal im französischen Fernsehen, zwischen vier Israelis und vier Palästinensern. Man hatte uns auf getrennte Studios verteilt, da die Palästinenser sich weigerten, mit uns zusammenzusitzen. Unsere Gruppe bestand aus Elie Wiesel, dem Journalisten Yeshayahu Ben-Porat, dem Beamten des Außenministeriums David Catarivas und mir. Mitten in der Sendung standen Wiesel und Catarivas auf und verließen aus Protest gegen die Haltung der Palästinenser das Studio; Ben-Porat und ich kämpften weiter.
Ein paar Wochen später, irgendwann im Juli 1967, kamen wir nach Israel: Man hatte mir für ein Jahr eine Gastprofessur für Geschichte an der Hebräischen Universität Jerusalem angeboten.
– 1 –
Ein Jahr nach unserem letzten Besuch fanden wir ein anderes Land vor. Mit dem Ausbruch der nationalistischen Hochstimmung schwelgte Israel in einem völlig neuen Bewußtsein von Macht, ja geradezu von «Übermacht». Für die Israelis und viele Juden in der Diaspora war es ein bisher nie gekanntes Gefühl. In Scharen strömten Touristen ins Land und sein «Imperium». Die wirtschaftliche Lage wendete sich jäh; auf die Stagnation vergangener Jahre folgte ein Konjunkturaufschwung. Innerhalb weniger Monate hatte sich sogar das Aussehen des Landes verändert: Überall wuselten arabische Arbeiter aus den besetzten Gebieten auf Tausenden neuer Baustellen herum; auf den Straßen der Städte schwebten Küchendüfte aus neu eröffneten Restaurants in der Sommerhitze. Im Frühjahr 1968, am zwanzigsten Jahrestag der Staatsgründung, ging der Erste Kanal des nationalen Fernsehens auf Sendung. Was den Frieden betraf, so war keiner in Sicht. Israel würde sich aus den besetzten Gebieten nicht zurückziehen, solange die arabischen Länder, wie sie auf ihrer Konferenz in Khartum Ende 1967 verlautbart hatten, alle Verhandlungen ablehnten.
In dem Jahr, das wir in Jerusalem verbrachten, hatte man keinerlei Schwierigkeiten, die Altstadt (den überwiegend arabischen Teil von Jerusalem) zu besichtigen und dort einkaufen oder essen zu gehen, so wie man auch sonst überall in den besetzten Gebieten umherreisen konnte, von Scharm el-Scheich an der Südspitze der Sinai-Halbinsel bis zum Katharinenkloster mitten auf dem Sinai, zum Suq (dem überdachten Markt) von Hebron oder zu den Hängen des Libanon. Man wurde mit offenen Armen empfangen, das Geschäft blühte: die Käufer gewannen (da anfangs die Preise extrem niedrig waren), und die Verkäufer gewannen noch mehr. Besatzer und Besetzte lebten in einmütiger Koexistenz – so schien es jedenfalls.
Wir liebten es, im arabischen Viertel der Altstadt zu bummeln, besonders durch den Suq. Die meisten Stände waren, für sich genommen, nicht einmal besonders beeindruckend, aber in ihrer hundertfachen Vielfalt zu beiden Seiten der dichtgedrängten engen Gasse, die vom Jaffator den Berg hinunter – oder vom Nablustor aus durch den Suq – führte, vereinten sich die Farben und der stechende Geruch der Gewürze zu einem Ganzen, das in seiner Opulenz die Sinne überwältigte und die Besucher leicht schwindlig – oder besser gesagt, benommen – machte.
Vom Suq aus konnte man in eine Seitengasse einbiegen, über die man in wenigen Minuten zur Grabeskirche gelangte. Die Kirche mit ihren vielfachen im Lauf der Jahrhunderte entstandenen Anbauten hatte nichts von der Schönheit europäischer Kathedralen. Gleich beim Eintreten war man zunächst peinlich verwirrt, denn Mönche der verschiedenen und untereinander verfeindeten christlichen Kirchen versuchten, einen in ihren jeweiligen Winkel der Kirche zu ziehen, in dem sie einem «ihr» Jesusgrab zeigen wollten. Diese Unannehmlichkeit war aber bei einigen der großen festlichen Ereignissen, besonders in der Karwoche und an Ostern, rasch vergessen. Bei unserem ersten Aufenthalt wohnten wir der Feier des «Heiligen Feuers» der griechisch-orthodoxen Kirche bei, und obgleich wir nur kurze Blicke auf das Feuer erhaschen konnten, waren wir bald von Tausenden brennenden Kerzen umgeben, die die dichtgedrängt stehenden Gläubigen an diesem heiligen Feuer entzündet hatten und die sie in ekstatischer Hingabe in den Händen hielten.
Folgte man vom Jaffator aus dem Hauptweg durch den Suq, erreichte man die Klagemauer und den über ihr mächtig aufragenden Tempelberg mit seinen beiden prächtigen Moscheen: dem Felsendom und der al-Aqsa-Moschee. 1967/68 war noch kein Platz vor der Mauer freigeräumt worden – dies geschah erst einige Jahre später –, was die Erhabenheit der Mauer zusätzlich steigerte; die riesigen Steine erhoben sich buchstäblich in ein paar Schritten Entfernung: Sie überwältigten nicht so sehr durch ein Gefühl von der Heiligkeit des Ortes (zumindest nicht uns), sondern weil sie die ihnen innewohnende große Geschichte ins Bewußtsein riefen.
Einer unserer beliebtesten und häufigsten Ausflüge war – wenn ab Herbst das Wetter es zuließ – die Fahrt mit dem Wagen von Jerusalem nach Jericho oder geradewegs ans Tote Meer, um dort im Wasser zu waten; zum Schwimmen eignete es sich weniger (jedenfalls, was mich betraf, selbst wenn man von ihm angeblich getragen wurde …). Die Straße von Jerusalem zum Toten Meer war ehrfurchtgebietend. Zunächst sah man nur ausgebrannte Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und Lastwagen der jordanischen Armee, die rechts und links der Strecke zu Dutzenden verstreut waren. Sehr bald jedoch bot sich ein anderer Anblick. Die kahlen Berge ringsum wirkten keineswegs trostlos; sie stiegen in fast zauberischer Stille auf und waren von einer herben Schönheit, auf die weder die Erinnerung noch die Phantasie vorbereitet hatten. Es war, wenn ich mich nicht irre, Ernest Renan, der diese unwirkliche Kargheit mit der Geburt des Monotheismus in Verbindung brachte. Und fuhr man am Spätnachmittag hinab, verfärbten sich die Berge von Moab auf der anderen Seite des Toten Meers violett, kurz bevor sie vor einem verblassenden, wolkenlosen Himmel zu einer dunklen Wand wurden. Entschied man sich dann für Jericho und ließ sich unter der Pergola eines Restaurants nieder, schmeckten Pita, Hummus mit Tahini und das Bier besser als sonst irgendwo, eben deshalb, weil man gerade eine so «spirituelle» ...