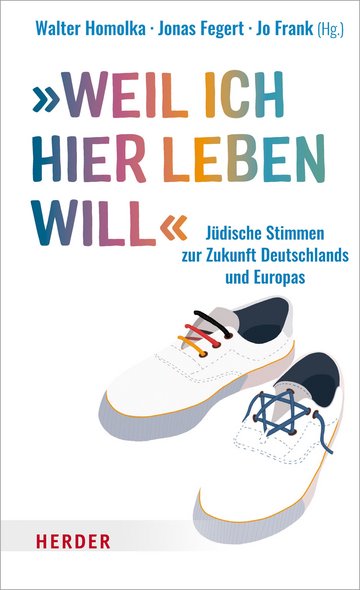Hinführung:
Zwischen Vielfalt und Vielfaltsverteidigung –
Ein Gespräch zwischen Senator Dr. Klaus Lederer und Rabbiner Prof. Walter Homolka
Das Buch »Weil ich hier leben will …« Jüdische Stimmen zur Zukunft Europas vereint Beiträge einer Generation junger Jüdinnen und Juden im Alter zwischen zwanzig und vierzig Jahren. Sie schildern ihre Vorstellungen für das jüdische Leben in Gegenwart und vor allem Zukunft. Worin unterscheidet sich diese Generation von anderen Generationen Jüdinnen und Juden in Deutschland?
Rabbiner Homolka: Unterscheidet sie sich? Das ist die Frage. Ich glaube, jede Generation hat eine besondere Herausforderung. Ich erinnere mich an das Buch von Peter Sichrovsky, Wir wissen nicht, was morgen wird, wir wissen wohl, was gestern war. Junge Juden in Deutschland und Österreich, das vor dem Fall der Mauer Aufsehen erregte. Die Fragen, die man sich damals stellte, waren: Warum bleibe ich in Deutschland, kann ich eine positive Perspektive für mein Leben hier gewinnen? Die Eltern und Großeltern der Jüdinnen und Juden, die im Band befragt wurden, waren teilweise in Deutschland »gestrandet«, hatten den Absprung verpasst, wollten auswandern, sind dann aber doch in Deutschland geblieben. Sie haben Familien gegründet, Karrieren verfolgt und ein »normales« Leben gelebt. Mit dem Fall der Mauer kamen alle möglichen Anreize zu denken, dass sich im »neuen Deutschland« etwas bewegt, und trotzdem gab es immer auch die Auseinandersetzung mit der Realität eines mehr oder weniger latenten Antisemitismus, der jüdisches Leben infrage stellte.
Was uns so bedrückt, ist, dass wir gedacht haben, es wäre eine grundlegend neue Sachlage eingetreten: dass Deutschland sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt, dass es eine Erinnerungskultur entwickelt, dass ein Jüdisch-Sein in Deutschland fast normal erscheint. Ich kann mich noch entsinnen, wie es immer hieß: »Es ist jetzt endlich normalisiert«, und ehe man sich versieht, kommt dann doch wieder die Erinnerung: So normal ist das eben alles nicht. Insofern ist es spannend, jetzt wieder zu fragen, was diese jungen Menschen, diese jungen Jüdinnen und Juden, hier in Deutschland hält – und unter welchen Bedingungen sie eine Perspektive für sich sehen. Das ist ja immerhin eine Generation, der die Welt offensteht.
Die Autorinnen und Autoren nehmen in ihren Beiträgen auch eine Standortbestimmung vor und beschreiben, welche jüdischen Migrationsgruppen mit welchen unterschiedlichen Kulturen und religiösen Praxen in Deutschland aufeinandertreffen. Senator Lederer, ist die Vielfalt der Jüdinnen und Juden, die in Berlin leben, auch eine Herausforderung?
Senator Lederer: Für die Stadtgesellschaft ist sie ein riesengroßes Geschenk! Berlin ist die Stadt, in der der Holocaust geplant und ins Werk gesetzt worden ist. Wir haben durch die Tatsache, dass Antisemitismus als Staatsideologie zur Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung des jüdischen Lebens in dieser Stadt geführt hat, einen unfassbaren Schatz an kulturellen Wurzeln verloren. Ich hänge keiner Illusion an, dass man die Zeit oder die Uhr zurückdrehen kann, aber allein die Tatsache, dass angeknüpft wird an abgeschnittene Geschichtsfäden, an Traditionsfäden dieser Stadtgesellschaft, dass versucht wird, jüdisches Leben in Berlin in Vielfalt und Buntheit neu zu etablieren, ist ein großer Gewinn.
Als 1989/90 die Mauer von der Oppositionsbewegung der DDR und von der Bevölkerung eingerissen wurde, habe ich jüdisches Leben wahrgenommen als das, was sich in den 1980er-Jahren zwischen SED-Führung einerseits und den verbliebenen jüdischen DDR-Bürgern andererseits entwickelt hat: Dass beispielsweise die Synagoge in der Oranienburger Straße wiederaufgebaut werden konnte, dass das Centrum Judaicum etabliert wurde, hatte natürlich auch etwas mit dem Streben der DDR nach internationaler Anerkennung zu tun, und das war 1989/90 vorbei. Auch in Ost-Berlin existierte eine jüdische Community, die ich allerdings als sehr säkularisiert in Erinnerung habe, soweit ich als junger Mensch das wahrnehmen konnte. Viele von ihnen verstanden ihre Geschichte mindestens auch als eine genuin antifaschistische. In den 1980er-Jahren hatte eine jüngere Generation der Ostberliner Gemeinde in der Gruppe »Wir für uns – Juden für Juden« mit der Suche nach der eigenen Identität begonnen. Nach 1990 entwickelte sich der Jüdische Kulturverein dann auch zum Anlaufpunkt für Jüdinnen und Juden aus Osteuropa. Sehr etabliert in der wiedervereinigten Stadt war die »alteingesessene« Jüdische Gemeinde Westberlins mit einer Verankerung und Einbindung ins Leben der Stadt.
Dann aber passierte etwas Unfassbares: Diese Stadt, die bestimmt, zehn, fünfzehn Jahre überhaupt damit gehadert hatte, was sie eigentlich sei – Hauptstadt, Kulturstadt, Ost-West-Drehscheibe, Olympiastandort –, begann nach der Jahrtausendwende, ein pulsierendes Leben zu führen, das eine große Anziehungskraft ausübte. Berlin hatte nicht nur einen großen Teil der bundesweit nahezu Viertelmillion sogenannter Kontingentflüchtlinge, also Jüdinnen und Juden aus den ehemaligen Ländern der Sowjetunion, aufgenommen. Jetzt wurde es auch für viele Jüdinnen und Juden aus Israel ein Anziehungspunkt. Beide Gruppen haben Berlin ganz bewusst als den Ort gewählt, an dem sie leben wollen. Insofern ist die heutige Vielfalt jüdischen Lebens ein Glücksfall und belebt die Stadt auf eine Art und Weise, von der man eigentlich nur träumen konnte angesichts der Geschichte unserer Stadt und der Geschichte unseres Landes. Eine völlig andere Frage ist, vor welche erinnerungskulturellen Herausforderungen uns das stellt.
Homolka: Ich glaube, der Senator hat etwas herausgestellt, was wirklich zu der Herausforderung hinzukommt: Diese unheimlichen Erwartungen, die die zugewanderten Jüdinnen und Juden an Deutschland hatten. Für sie war die Ankunft hier sozusagen die Ankunft im Gelobten Land, in dem man sich etablieren wollte. Da trat auch für einen Moment die Geschichte Deutschlands und der Schoah in den Hintergrund. Auch, weil die deutsche Politik sagte: »Wir haben die Vergangenheit bearbeitet – jetzt kommen sogar jüdische Menschen zu uns, die hier ihre Zukunft verbringen wollen!« Schaut man auf die vielen Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, muss festgestellt werden, dass an der Vergangenheit zwar gearbeitet wird, von bearbeitet kann aber nicht die Rede sein. Hinzu kommt, dass die Generationen vor 1989, die hier aufgewachsen sind und die auch teilweise Verfolgte des NS-Regimes waren, eine ganz und gar andere Perspektive auf das Leben in Deutschland und auf ihr Leben als Jüdinnen und Juden in Deutschland hatten. Das macht dieses Buch aber auch so unwahrscheinlich wichtig: Wir hören hier Stimmen aus einer großen Vielfalt der jüdischen Gemeinschaft: von postsowjetischen und postmigrantischen Stimmen, von israelischen, deutschen – und dies verbindet sie – jüdischen Stimmen der Gegenwart.
Die Arbeit des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks zeigt, wie stark junge Jüdinnen und Juden in den letzten Jahren mit Identitätsfragen beschäftigt waren. In den vorliegenden Beiträgen lässt sich der unbedingte Wille zur Mitgestaltung feststellen: Es werden Vorschläge unterbreitet, wie jüdische Positionen in die Gesellschaft wirken können. Senator Lederer, wo könnte das Land Erfahrungen und Kompetenzen jüdischer Menschen brauchen?
Lederer: Grundsätzlich unterscheide ich nicht zwischen jüdischen und nichtjüdischen Menschen hierzulande, wenn es um Kompetenzen geht und um die Art und Weise, sich einzubringen. Vielmehr erhebe ich den Anspruch, dass alle gleichermaßen, gleich welcher Herkunft, welcher Ethnie, welchen Glaubens, die Chance haben, sich an unserer Gesellschaft zu beteiligen und sich in ihr zu entfalten. Die Vielfalt unserer Gesellschaft ist eben eine Chance, weil aus ihr etwas Neues erwächst. Eine Vielfalt, die natürlich voraussetzt, dass diejenigen, die sich einbringen wollen, dies aus einem Standpunkt heraus tun, den sie für sich selbst gefunden haben.
Wenn wir uns als Stadt Berlin heute unserer Weltoffenheit, unserer Freiheit rühmen, wird das oft als Stadtmarketing abgetan, ohne dabei zu beachten, dass Berlin – und nicht Gesamtdeutschland – in gewisser Weise auch deswegen ein Hotspot der Vielfalt ist, weil Menschen, die es woanders nicht aushalten, sich nach Berlin bewegen. Ich kann das aus der Perspektive von queeren Menschen sagen, die zum Teil vom Land regelrecht geflohen sind, um in der Stadt das Leben leben zu können, das sie leben möchten. Insofern ist die Frage, und das ist auch der Lackmustest: Wie stabil sind eigentlich diese Vielfalt und diese Freiheit, derer wir uns so rühmen? Es gab ein Momentum in der deutschen Geschichte, in dem schien der Umgang mit der Vergangenheit geklärt zu sein, da schien das Erinnerungsnarrativ eindeutig zu sein, da war die Frage des Bekenntnisses zum jüdischen Leben in Deutschland genauso wie das Bekenntnis zum Existenzrecht des Staates Israels unangefochten. In den 1980er-Jahren hatte man einen relativ klaren Kanon erinnerungskultureller Bekenntnisse, und man hatte vermutlich – aber das vermögen andere besser einzuschätzen – auch ein weitgehend einheitliches Erinnerungsnarrativ der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. Heute blicken wir auf eine Einwanderungs- und Migrationsgesellschaft, in der schon die Vielfalt der Narrative innerhalb der jüdischen Gemeinschaft viel größer und bunter geworden ist, weil jemand in dritter oder vierter Generation als jüdischer Mensch aus Osteuropa Geschichte vielleicht ganz anders vermittelt und erzählt bekommen...