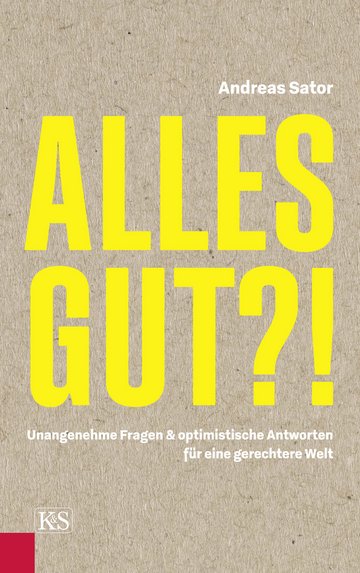1. Beim Einkaufen die Welt retten? Es ist kompliziert
Wenn das T-Shirt bei H&M fünf oder zehn Euro kostet, fühlst du dich dann schlecht? Ich mich bislang nicht wirklich. Ja, die Bilder sind schrecklich, und Rana Plaza habe ich bis heute im Kopf – mehr als 1100 Menschen sind 2013 beim Einsturz von Textilfabriken in Bangladesch gestorben. Aber so übel die Jobs auf uns hier in Österreich auch wirken mögen, zumindest schaffen Fabriken für die Menschen dort Arbeit. Sie sind eine zusätzliche Option vor Ort. Vielen Menschen bieten sie die Chance, der extremen Armut zu entkommen. Zumindest habe ich mir das bisher eingeredet. Gibt es dafür eigentlich irgendwelche Belege? Sorgen Konzerne, die in armen Ländern produzieren, dafür, dass sich die Situation mit der Zeit bessert? 2017 wurden Ergebnisse einer Studie präsentiert, die meine These zumindest anzweifeln.2 Zwei Ökonomen der University of Chicago und der Oxford University haben sich obige Frage gestellt. In einem Experiment in Äthiopien, einem der ärmsten Länder der Welt, wo gerade mit viel Geld aus dem Ausland, vor allem aus China, Fabriken entstehen, haben sie tausend Bewerber*innen ein Jahr lang begleitet. Ihre Annahmen waren ähnlich wie meine: Die Jobs sind schlecht, aber immerhin Jobs. In einem Land mit wenig Perspektiven würde die Nachfrage nach den neuen Jobs riesig sein. Zu ihrer Überraschung kündigte die Mehrheit binnen weniger Monate. Sie gingen zurück auf den Bau oder verkauften Kleinigkeiten am Markt. Dazu kommt: Die Jobs in den Fabriken brachten nicht mehr Geld ein als die sonstigen und waren noch dazu gefährlicher. Übrig blieb in der Fabrik nur ein Drittel der Menschen. Jene, die sonst nichts fanden.
Was heißt das für mich? Ausländische Fabriken, in denen meine Kleidung entsteht, verbessern nicht automatisch das Leben der Menschen. Die Jobs in den Fabriken sind unbeliebt. Für die, die keine anderen Optionen haben, schaffen sie in einem der ärmsten Länder der Welt aber immerhin ein kleines Einkommen. Wenn Fabriken keine Wunderwaffe im Hier und Jetzt sind – verbessern sie dann zumindest auf längere Sicht die Lage in diesen Ländern? Ich schaue in meinen Kasten, nehme eine Jogginghose heraus. »Made in Bangladesh« steht da – kein Zufall, das Land ist mittlerweile zum zweitgrößten Exporteur von Kleidung nach China aufgestiegen.3 Fast alles, was Bangladesch ins Ausland verkauft, sind T-Shirts, Pullover und Socken. H&M lässt dort in unzähligen Fabriken produzieren. Wenn meine Nachfrage also gut für die Welt ist, dann muss sich das in Bangladesch zeigen. Tut es das? Wie sich gleich herausstellen wird: Ja.
Yale-Ökonom Mushfiq Mobarak, er ist in Bangladesch aufgewachsen, hat genau dazu geforscht. Seine Studie legt nahe, dass der Textilsektor das Leben von Frauen im Land fundamental zum Besseren verändert hat.4 Fast alle der vier Millionen Menschen, die in den Fabriken arbeiten, sind nämlich Frauen. Ihre Lebenserwartung ist seit 1990 um 16 Jahre gestiegen. In Österreich in derselben Zeit nur um vier Jahre. Das hat viele Gründe, aber der Textilsektor hat daran allem Anschein nach einen Anteil. Denn das Leben jener Menschen, die in der Nähe von Fabriken wohnen, hat sich besonders verbessert. Mädchen heiraten laut Mobarak später und bleiben länger in der Schule. Früher sei die Schule nicht so wichtig gewesen. Heute bekämen jene, die gut lesen, schreiben und rechnen können, bessere Jobs – in den Fabriken. Weil sich aus heutiger Sicht die Schule später auch einmal finanziell auszahlt. Bangladesch ist nicht nur wegen seines Textilsektors interessant, sondern insgesamt seit einiger Zeit ein kleines Wunder der Entwicklung. Schon bevor die großen Konzerne dort für das Ausland produzieren ließen, hat sich viel zum Besseren verändert, obwohl das kaum jemand erwartet hatte. Das Land ist noch keine 50 Jahre unabhängig, bis dahin war es eine der ärmsten Regionen Pakistans, eines an und für sich schon ziemlich armen Landes.5 Wahiduddin Mahmud, ein Ökonom aus der Hauptstadt Dhaka, schreibt, dass NGOs im Land besonders wichtige Arbeit geleistet haben.6 In den 1980ern war nur ein Prozent der Bevölkerung geimpft, innerhalb von zehn Jahren waren es über 70 Prozent, Unicef nannte das »beinahe ein Wunder«.7 Die NGO BRAC verteilte kleine Salz-Zucker-Drinks, die man bei Durchfall zu sich nehmen sollte. Die sorgen dafür, dass man nicht dehydriert. 1980 starb noch eines von fünf Kindern, bevor es fünf Jahre alt wurde, und zwar oft, weil sie der Durchfall so schwächte, heute nur mehr eines von 30. Ein Rückgang der Sterblichkeit um 84 Prozent. Sie ist noch immer viel zu hoch. Denn in Österreich stirbt nur ein Kind von 300 vor dem fünften Geburtstag. Aber die Entwicklung ist erstaunlich und schnell. Auch kleine Kredite für arme Menschen, die keinen Zugang zu Banken hatten, haben geholfen. Die mittlerweile berühmte Grameen Bank von Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus nahm dort ihren Ausgang. All die Arbeit von engagierten Menschen hat gemeinsam mit schlauer Politik dafür gesorgt, dass sich die Lage in Bangladesch so stark verbessert. Heute ist das Land in die Weltmärkte integriert, und die Fabriken, in denen meine Kleidung hergestellt wird, machen es möglich, dass die Armut noch stärker zurückgeht, denn sie bringen Geld und Wissen ins Land. Dass der Textilsektor in der Entwicklung hilft, wie der Ökonom Mushfiq Mobarak in seiner Studie bilanziert, ist keine skurrile These eines Außenseiters, seine Studie fügt sich in viele andere Arbeiten ein, die gemeinsam ein positives Bild zeichnen. Menschen finden nicht nur Arbeit, in Südasien verdienen sie im urbanen Textilsektor auch mehr als mit Arbeit auf dem Land. Mit der Zeit haben Menschen die Chance, bessere Jobs zu finden. Lokale Firmen profitieren außerdem vom ausländischen Know-how.8
Tab. 1: Lebenserwartung bei der Geburt in Jahren (in Ländern mit Textilindustrie)
Ist dann also alles gut? Nicht ganz. Das Leben mit Fabriken scheint laut Mobarak besser zu sein als ohne. Das heiße aber nicht, dass man als Einzelperson im Westen nichts tun könne. Firmen hätten wenige Anreize, in bessere Standards zu investieren. Zwar seien die Fabriken in Bangladesch heute deutlich sicherer als vor dem Einsturz von Rana Plaza – damit aber nicht tausend Menschen sterben müssen, damit sich etwas ändert, müssten Konsumenten wachsam sein. »Überlegen Sie, ein bisschen mehr Geld für bessere Kleidung zu bezahlen«, rät mir Mobarak. »Üben Sie Druck auf Firmen aus, bei denen Sie einkaufen, oder kaufen Sie Kleidung, die unter gewissen Standards produziert wurde.«9 Aber was ist bessere Kleidung, und wo kriegt man sie? Bei welchen Firmen kann ich einkaufen, wenn ich mich nicht damit abfinden will, dass sich die Lage eh dann irgendwann einmal langsam ein bisschen bessert?
Was ist bessere Kleidung?
Ich mache mich auf die Suche. Egal bei welchem Hersteller, auf der jeweiligen Homepage wird man schnell fündig. Die vielen Skandale, Proteste und Unfälle der Vergangenheit sorgen dafür, dass es sich kaum eine Marke leisten kann, sich nicht damit zu befassen. So findet man bei Zara-Mutter Inditex Regeln für Zulieferer, auch Levi Strauss und H&M erklären sich. Aber ist das vertrauenswürdig? Glaube ich dem Bäcker, wenn er mir sagt, er verkauft die besten Semmeln der Welt? Lieber nicht. Die Clean Clothes Campaign hilft weiter, eine NGO mit einigem Einfluss, die sich seit Langem für bessere Bedingungen in der Industrie einsetzt. Sie fordert die Unternehmen dazu auf, ihre Zulieferer offenzulegen. Die großen Textilfirmen lagern die Produktion großteils aus. Wer nicht preisgibt, wo Fabriken stehen, wird dafür schon seine Gründe haben. Und siehe da: Zara ist verschwiegen, H&M hingegen sehr offen. Auch Levi Strauss, C&A, Nike oder Adidas sind transparenter, kik, Ralph Lauren oder Mango dagegen gar nicht.10 Gut zu wissen. Vor vier Jahren hat die NGO Firmen darauf untersucht, wie sehr diese darauf achten, ob Mitarbeiter*innen bei Lieferanten von ihrem Lohn leben können. Ich habe etwa schon ältere Laufschuhe von New Balance, einer US-Firma, die sehr schlecht abschneidet – und einmal per Mail nachgefragt, warum das so ist.
Ich habe also erste Hinweise, aber das reicht noch lange nicht. Ich will mehr wissen und rufe Nunu Kaller an. Sie ist Konsumentensprecherin bei Greenpeace. Worauf soll ich beim Einkaufen achten? Auf die Umwelt, sagt sie. Ein Viertel der weltweiten Insektizide lande auf Baumwolle. Wenn Stoffe gefärbt würden, beim Spinnen, beim Bedrucken, bei allem, was mit Wasser zu tun hat, sei der Einsatz von Chemikalien irre. Greenpeace hat deshalb die sogenannte Detox-Kampagne gestartet. 76 Modemarken haben sich dazu verpflichtet, bestimmte Chemikalien nicht mehr einzusetzen.
Bis 2020 läuft die Maßnahme, online kann man nachsehen, wie weit die Firmen mit der Umsetzung sind. Nike ist hintennach. Weil ich viele Sportsachen von Nike besitze, habe ich die Firma auf Twitter gefragt, warum das so ist. H&M und Zara sind beispielsweise Vorreiter.
Aber: Die beiden Konzerne...