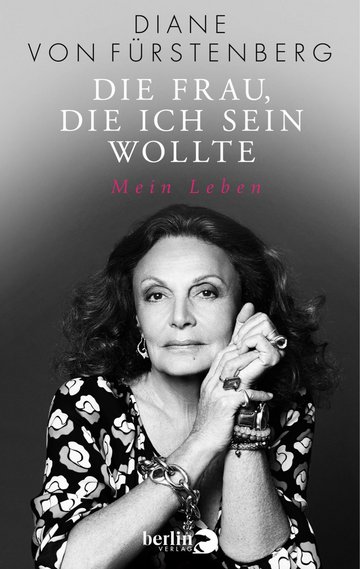1
FAMILIE
Auf dem Bücherregal in meinem New Yorker Schlafzimmer steht ein großer Bilderrahmen. In ihm steckt eine Seite, die aus einer deutschen Zeitschrift von 1952 herausgerissen wurde. Sie zeigt eine elegante Frau mit ihrer kleinen Tochter auf dem Basler Bahnhof, wo beide auf den Arlberg-Orient-Express warten. Das Mädchen kuschelt sich in den weiten Mantel der Mutter und verzehrt eine Brioche.
So wurde ich im zarten Alter von fünf Jahren zum ersten Mal in einer Zeitschrift abgebildet. Es ist ein reizendes Bild. Juliette, die ältere Schwester meiner Mutter, schenkte es mir zu meiner ersten Hochzeit, aber erst kürzlich wurde ich mir seiner wahren Bedeutung bewusst.
Oberflächlich betrachtet ist es das Foto einer auffallend modebewussten, offensichtlich wohlhabenden Frau, die mit ihrem kleinen lockenköpfigen Mädchen unterwegs in den Skiurlaub ist. Die Frau blickt nicht direkt in die Kamera, aber man erkennt den Hauch eines Lächelns auf ihrem Gesicht, als wüsste sie, dass sie fotografiert wird. Eine elegante Erscheinung. Nichts deutet darauf hin, dass sie nur wenige Jahre zuvor auf einem anderen deutschsprachigen Bahnhof gestanden hatte: bei ihrer Rückkehr aus einem Konzentrationslager der Nazis, in dem sie dreizehn Monate verbringen musste – ein Bündel aus Haut und Knochen, vor Hunger und Erschöpfung dem Tod nahe.
Was fühlte sie, als der Fotograf sie nach ihrem Namen fragte, der zusammen mit dem Bild veröffentlicht werden sollte? Stolz, denke ich. Stolz darauf, dass sie ihm mit ihrem Stil und ihrer Eleganz aufgefallen war. Nur sieben Jahre waren seitdem vergangen. Sie war keine Nummer mehr. Sie hatte einen Namen, warme, schöne, saubere Kleidung und darüber hinaus – und das zählte mehr als alles andere – eine Tochter, ein gesundes, kleines Mädchen. »Gott hat mir das Leben gerettet, damit ich dieses Geschenk an dich weitergeben konnte«, schrieb sie mir jedes Jahr zu meinem Geburtstag an Silvester. »In dem Moment, als du geboren wurdest, gabst du mir mein Leben zurück. Du bist meine Fackel, meine Freiheitsflagge.«
Jedes Mal, wenn ich in der Öffentlichkeit über meine Mutter spreche, versagt meine Stimme. Und bei jeder Rede, die ich halte, bin ich mir bewusst, dass ich dazu nicht in der Lage wäre, wenn Lily Nahmias mich nicht geboren hätte. Manchmal fühlt es sich merkwürdig an, dass ich immer wieder auf ihre Geschichte zu sprechen komme, aber irgendetwas zwingt mich dazu. Sie ist der Schlüssel dafür, was für ein Kind ich war und wie ich zu der Frau wurde, die ich bin.
»Ich möchte Ihnen die Geschichte einer jungen Frau erzählen, die mit zweiundzwanzig Jahren fünfundfünfzig Pfund wog, kaum mehr als das Gewicht ihrer Knochen«, sagte ich in einem Harvard-Seminar zum Thema »Gesundheit junger Mädchen«. »Sie wog nur fünfundfünfzig Pfund, weil sie dreizehn Monate in den Konzentrationslagern Auschwitz und Ravensbrück verbracht hatte. Es grenzt an ein wahres Wunder, dass diese junge Frau nicht starb, obwohl sie dem Tod sehr nahe war. Als sie befreit wurde und zu ihrer Familie nach Belgien zurückkehrte, fütterte ihre Mutter sie wie ein Vögelchen: Alle fünfzehn Minuten bekam sie einen ganz kleinen Happen zu essen und dann noch einen, wodurch sie sich wie ein Ballon fühlte, der langsam und allmählich aufgeblasen wurde. Nach ein paar Monaten hatte sie fast ihr ursprüngliches Gewicht wieder erreicht.«
Immer wenn ich bei der Geschichte meiner Mutter an diesem Punkt angelangt bin, geht ein Raunen durchs Publikum, vielleicht weil es so schockierend und unerwartet ist oder weil für die jungen Zuhörer, die nur eine vage Vorstellung von Auschwitz haben, durch mich ein Stück Geschichte lebendig wird. Es ist wohl schwer vorstellbar, dass dieses kerngesunde weibliche Energiebündel, das da zu ihnen spricht, eine Mutter hatte, die einst nur fünfundfünfzig Pfund wog. Was auch immer der Grund ist, ich möchte und muss meine Mutter, ihren Mut und ihre Kraft ehren. Denn dies hat mich zu der Frau gemacht, die ich sein wollte.
»Gott hat mir das Leben gerettet, damit ich dieses Geschenk an dich weitergeben konnte.« Ihre Worte hallen jeden Tag in mir nach. Ich empfinde es als meine Pflicht, all das Leid, das sie erdulden musste, wettzumachen, stets die Freiheit in Ehren zu halten und das Leben voll auszukosten. Meine Geburt war ihr Triumph. Sie hätte nicht überleben sollen, und ich hätte nicht geboren werden sollen. Wir haben sie Lügen gestraft. Am Tag meiner Geburt wurden wir beide zu Siegerinnen.
Ich gebe an dieser Stelle ein paar der Lektionen wieder, die meine Mutter mir eingetrichtert hat und die mir gute Dienste erwiesen haben. »Angst kommt nicht in Frage.« – »Verweile nicht bei der düsteren Seite der Dinge, sondern betrachte das Schöne an ihnen und baue darauf auf.« – »Wenn sich eine Tür schließt, schau, welche andere du stattdessen öffnen kannst.« – »Gib niemals jemand anderem die Schuld für das, was dir widerfahren ist, egal wie schlimm es auch sein mag. Vertrau auf dich, denn du allein bist für dein Leben verantwortlich.« Sie lebte nach diesen Grundsätzen. Trotz allem, was sie durchgemacht hatte, wollte sie niemals als Opfer angesehen werden.
Früher habe ich so gut wie nie über meine Mutter gesprochen. Ich hielt sie für selbstverständlich, wie alle Kinder das tun. Erst als sie 2000 starb, erkannte ich überhaupt, welch unglaublich großen Einfluss sie auf mich hatte und wie viel ich ihr verdanke. Wie jedes Kind hatte ich ihr keine übertrieben große Aufmerksamkeit geschenkt. »Ja, ja, das hast du mir schon gesagt«, unterbrach ich sie oder überhörte ihre Worte. Oder ich regte mich über die ungebetenen Ratschläge auf, die sie meinen Freundinnen ständig gab. Sie ärgerten mich. Jetzt allerdings finde ich, dass ich inzwischen selbst die nötige Erfahrung und Altersweisheit besitze, um anderen ungefragt Ratschläge zu erteilen, und nutze jede Gelegenheit, um die Grundsätze, die meine Mutter mich gelehrt hat, an meine Kinder, Enkel und an jeden, mit dem ich spreche, weiterzugeben. Jetzt bin ich so, wie sie einst war.
Als kleines Mädchen lebte ich in Brüssel. Damals wusste ich nicht, warum meine Mutter auf dem linken Arm zwei in blauer Farbe eintätowierte Zahlen hatte. Ich dachte, sie seien eine Art Schmuck, und hätte gerne selbst so etwas gehabt, damit meine Arme nicht so kahl aussahen. Ich verstand auch nicht, warum die Haushälterin mir oft sagte, ich solle sie nicht stören, wenn sie sich in ihr Schlafzimmer zurückzog. Aber instinktiv wusste ich, dass meine Mutter ihre Ruhe brauchte, und so ging ich auf Zehenspitzen durchs Haus, um sie ja nicht zu stören.
Manchmal aber ignorierte ich die Anweisungen der Haushälterin, sammelte meine geliebten kleinen Bilderbücher ein und schlich mich in den abgedunkelten Raum. Ich hoffte, sie würde lächeln und mir aus ihnen vorlesen. Meistens tat sie es. Sie liebte Bücher und brachte auch mir bei, sie zu schätzen. Und sie las mir meine kleinen Bilderbücher so oft vor, dass ich sie schließlich auswendig kannte. Es machte mir großen Spaß, so zu tun, als könne ich schon lesen und mich damit zu brüsten, während ich gewissenhaft darauf achtete, an der richtigen Stelle umzublättern.
Meine Mutter war sehr streng. Ich zweifelte nie daran, dass sie mich liebte, aber wenn ich etwas sagte, das nicht ihre Zustimmung fand oder nicht ihren Erwartungen entsprach, sah sie mich finster an oder kniff mich. Ich musste mich dann, mit dem Gesicht zur Wand, in die Ecke stellen. Manchmal ging ich von allein in die Ecke, weil ich wusste, dass ich etwas Unrechtes getan hatte. Sie war viel mit mir zusammen, manchmal spielten wir auch, aber meistens brachte sie mir irgendetwas bei. Sie las mir Märchen vor und zog mich auf, wenn ich mich dabei ängstigte. Ich erinnere mich, dass sie sich einmal einen Spaß daraus machte, mir zu erzählen, ich sei als Kind ausgesetzt worden, und sie habe mich im Müll gefunden. Ich fing bitterlich zu weinen an und konnte mich gar nicht mehr beruhigen, bis sie mich in die Arme schloss und tröstete. Ich sollte stark und furchtlos sein.
Sie war sehr fordernd. Noch bevor ich lesen konnte, hielt sie mich dazu an, die Fabeln von La Fontaine aus dem siebzehnten Jahrhundert auswendig zu lernen und aufzusagen. Sobald ich alt genug war, um zu schreiben, bestand sie darauf, dass ich Geschichten und Briefe schrieb, die orthografisch und grammatikalisch korrekt waren. Ich erinnere mich, wie stolz ich war, wenn sie mich dafür lobte.
Um mir jede Form von Schüchternheit auszutreiben, musste ich von Kindesbeinen an bei jeder Familienfeier eine Rede halten. So brachte sie mir bei, mich bei jeder Rede, egal vor welchem Publikum, wohl zu fühlen. Wie viele Kinder hatte auch ich Angst vor der Dunkelheit, aber anders als die meisten Mütter sperrte sie mich in eine dunkle Abstellkammer und wartete vor der Tür, damit ich von allein lernte, dass es nichts gab, wovor ich mich fürchten musste. Das war nur eine der vielen Gelegenheiten, bei denen sie zu sagen pflegte: »Angst kommt nicht in Frage.«
Meine Mutter hielt nichts davon, Kinder zu sehr zu verhätscheln oder überzubehüten. Sie wollte mich zu einem unabhängigen Menschen erziehen, der selbst die Verantwortung für sich übernahm. Meine frühesten Erinnerungen sind die an gemeinsame Reisen mit meinen Eltern, bei denen ich allein im Hotelzimmer zurückblieb, während sie zum Essen gingen. Ich fand das weder schlimm noch fühlte ich mich verlassen. Im Gegenteil, ich war stolz darauf, dass sie mir zutrauten, allein zu bleiben. Gern spielte ich dann für mich allein und fühlte mich dabei sehr erwachsen. Bis zum heutigen Tag empfinde ich das gleiche Gefühl von Freiheit, wenn ich allein in einem Hotel einchecke.
Erlaubten meine Eltern mir, sie ins Restaurant zu begleiten, dann...