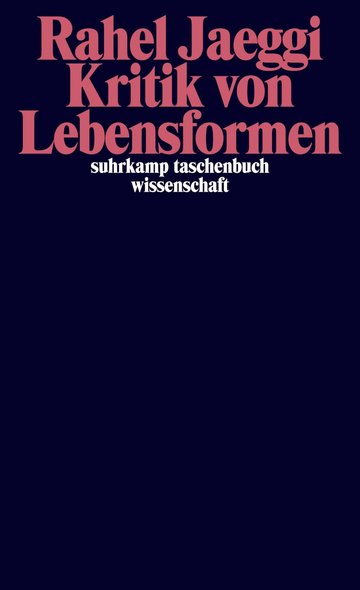9Vorwort
Die Kritische Theorie der Gesellschaft hat […] dagegen die Menschen als die Produzenten ihrer gesamten historischen Lebensformen zum Gegenstand. […] Was jeweils gegeben ist, hängt nicht allein von der Natur ab, sondern auch davon, was der Mensch über sie vermag.
Max Horkheimer
Bundestagswahlen, Feierstunden der Olympiade, Aktionen eines Scharfschützenkommandos, eine Uraufführung im Großen Schauspielhaus gelten als öffentlich. Ereignisse von überragender öffentlicher Bedeutung wie Kindererziehung, Arbeit im Betrieb, Fernsehen in den eigenen vier Wänden gelten als privat. Die im Lebens- und Produktionszusammenhang wirklich produzierten kollektiven gesellschaftlichen Erfahrungen der Menschen liegen quer zu diesen Einteilungen.
Oskar Negt und Alexander Kluge
Lassen sich Lebensformen kritisieren? Lässt sich von Lebensformen sagen, ob sie als Lebensformen gut, geglückt oder gar rational sind? Seit Kant gilt als ausgemacht, dass sich Glück oder das gute Leben im Gegensatz zum moralisch Richtigen philosophisch nicht bestimmen lassen. Und mit John Rawls und Jürgen Habermas schlagen die zurzeit wohl einflussreichsten Positionen der politischen Philosophie unter Verweis auf den irreduziblen ethischen Pluralismus moderner Gesellschaften vor, sich der philosophischen Diskussion des ethischen Gehalts von Lebensformen zu enthalten. Die Philosophie zieht sich damit von der sokratischen Frage, »wie zu leben sei«, zurück und beschränkt sich auf das Problem, wie angesichts der Vielzahl miteinander inkommensurabler Vorstellungen des guten Lebens ein gerechtes Zusammenleben als Nebeneinander verschiedener Lebensformen gesichert werden kann. Die politische Ordnung des liberalen Rechtsstaats stellt sich entsprechend als der Versuch einer lebensformneutralen Organisation dieses Zusammenlebens dar. Sofern es dann aber nicht mehr um die richtige gemeinsame Lebensform geht, sondern um das möglichst konfliktfreie Miteinander verschiedener Lebensformen, werden damit 10Fragen nach der Art und Weise, in der wir unser Leben führen, in den Bereich privater Präferenzen verschoben. Wie über Geschmack lässt sich über Lebensformen dann nicht mehr streiten. Sie werden zu einer unzugänglichen black box; mit Gründen kritisieren lassen sich allenfalls ihre Effekte.
Nun gibt es für eine solche Position naheliegende Gründe. Nicht nur ist der Zweifel berechtigt, ob sich angesichts der fundamentalen Unterschiede in Bezug auf Weltauffassungen und ethische Überzeugungen so leicht eine Übereinstimmung zwischen den Beteiligten herstellen ließe. Auch gehört der Wunsch, sich hinsichtlich der Gestaltung des eigenen Lebens nicht von (philosophischen) Sittenrichtern »hereinreden lassen« zu wollen, zu den unhintergehbaren Komponenten unseres modernen Selbstverständnisses. Deshalb mag es so aussehen, als ob die liberale black box zu den Bedingungen der Möglichkeit moderner Selbstbestimmung gehört und erst den Freiraum schafft, in dem sich eine Vielfalt von Lebensweisen ungestört entwickeln (oder erhalten) kann.
Die vorliegende Untersuchung ist von der Vermutung geleitet, dass an dieser These etwas nicht stimmt, ja, dass es sich in mancher Hinsicht geradezu umgekehrt verhält. Wenn wir die innere Verfasstheit unserer sozialen Praktiken und Lebensformen der »außerphilosophischen Dunkelheit« überlassen, wie der kanadische Philosoph Charles Taylor es ausgedrückt hat, geraten wir in Gefahr, sie auf unangemessene Weise als gegeben hinzunehmen. Wir erklären damit etwas, das »öffentliche Bedeutung« hat, vorschnell zur unhintergehbaren Identitätsfrage und entziehen damit Themenbereiche der rationalen Argumentation, die man aus dem Einzugsbereich demokratisch-kollektiver Selbstbestimmung nicht herauslösen sollte. Vielleicht sollte man die Beweislast umkehren: Die ethische Frage, »wie zu leben sei«, lässt sich aus den Prozessen individueller, aber auch kollektiver Willensbildung gar nicht so leicht ausklammern. Sie ist in jeder gesellschaftlichen Formation implizit oder explizit immer schon beantwortet. Das gilt auch noch für diejenige gesellschaftliche Organisationsform, die sich dem Pluralismus von Lebensformen verschrieben hat. Dann aber ist die Frage nach der Möglichkeit einer Kritik von Lebensformen in gewisser Weise gar nicht richtig gestellt. Nicht trotz, sondern gerade angesichts der Situation moderner Gesellschaften – als der »ungeheuren Macht, die alles an sich reißt« (Hegel) – lässt sich die 11Bewertung von Lebensformen nicht ins Reservat partikularer Vorlieben und unhintergehbarer Bindungen abdrängen.
Das wird insbesondere in gesellschaftlichen Konflikt- und Umbruchsituationen deutlich. So gibt es Situationen, in denen durch neue Technologien – man denke an die Gentechnologie – bislang unhinterfragte ethische Grundsätze plötzlich zur Debatte stehen. Aber auch die Konfrontation mit anderen Lebensformen kann zu Konflikten, Krisen und Selbstverständigungskrisen führen, in denen der Gehalt und die Grundorientierungen der eigenen wie der fremden Lebensform selbst ins Blickfeld geraten und eingelebte soziale Praktiken fraglich werden. Man muss hier nicht gleich an die vielerorts fälschlicherweise zum »Kampf der Kulturen« hypostasierten Konflikte oder an Grundlagenkrisen unserer moralischen Bezugssysteme denken. Auch ganz alltägliche Kontroversen um die Gestaltung des städtischen Raums[1] oder der öffentlichen Kinderbetreuung,[2] um die Vermarktlichung von Gütern wie Gesundheit, Bildung oder Wohnraum oder um das Selbstverständnis unserer Gesellschaft als Arbeitsgesellschaft lassen sich als Auseinandersetzung um die Integrität und den Zuschnitt von Lebensformen verstehen.
Einer Kritik von Lebensformen geht es also nicht etwa (im Sinne einer luxurierten Philosophie der Lebenskunst) um »Sahnehäubchenfragen« des guten Lebens, die zu stellen sich erst lohnte, wenn die Basisfragen gesellschaftlicher Organisation gelöst wären. Es geht um die innere Gestalt jener Institutionen und überindividuellen Zusammenhänge, die unser Leben formen und innerhalb 12derer sich unsere Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten erst ergeben. Wenn nun aber das Projekt der Moderne, der Anspruch der Individuen darauf, »ihr eigenes Leben zu leben«, sich nicht nur in der einfachen Freiheit gegenüber der Einmischung anderer realisiert, dann ist – so die hier verfolgte These – die öffentliche und auch philosophische Reflexion über Lebensformen weniger eine problematische Intervention in nicht zu hinterfragende Residuen individueller oder kollektiver Identität als vielmehr die Bedingung der Möglichkeit einer Transformation und Aneignung der eigenen Lebensbedingungen. Die Kritik an Lebensformen, oder besser: eine kritische Theorie der Kritik von Lebensformen, so wie ich sie hier konzipieren will, soll dann nicht etwa einem Rückfall in vormodernen Paternalismus das Wort reden, sondern die Bedingungen dessen untersuchen, was sich in der Traditionslinie der Kritischen Theorie als Ferment individueller wie kollektiver Emanzipationsprozesse auffassen lässt.
Von der gefürchteten »Sittendiktatur« unterscheidet sich eine solche Perspektive auch dadurch, dass sie Teil einer Suchbewegung ist, deren Ausgangspunkt nicht das Beharren auf der einen, richtigen Lebensform, sondern die Einsicht in die vielfältigen Defizite der eigenen wie der fremden Lebensformen ist. Wie Hilary Putnam es formuliert: »Unser Problem besteht nicht darin, dass wir zwischen einer gegebenen Anzahl von ›besten Lebensweisen‹ wählen müssten; unser Problem besteht darin, dass wir nicht einmal eine einzige solcher ›besten Lebensweisen‹ kennen.«[3] Wenn wir aber keine einzige »gute Lebensform« kennen, so hätten wir diese erst in Prozessen zu entwickeln, in denen schon die Vorstellung von unhintergehbaren »Identitäten« und der damit verbundenen »Konzeptionen des Guten« sich auflöst. Die Grenze zwischen dem »Innerhalb« und dem »Außerhalb« einer Lebensform, auf der die Vorstellungen von deren Unhintergehbarkeit in einiger Hinsicht beruhen, wird damit, ebenso wie das hier in Anspruch genommene kollektive »Wir«, durchlässig. Auch der Unterschied zwischen inter- und intrakulturellen Konflikten fällt dann nicht mehr groß ins Gewicht. Ob wir uns – interkulturell – über arrangierte Ehen oder – intrakulturell – über gay marriage streiten, ist, wenn 13man die Trennung zwischen Innen und Außen in der hier eingeschlagenen Perspektive zu obstruieren versucht, keine kategoriale Differenz, sondern allenfalls eine Frage der kontextspezifischen Sensibilität. Lebensformen sind, diesem Verständnis nach, nicht nur Gegenstand, sondern immer auch auch Resultat von Auseinandersetzungen.
Der Ausgangspunkt meiner Untersuchung ist die Annahme, dass wir Lebensformen nicht nur kritisieren können, sondern dass wir sie (und damit uns in unseren Lebensvollzügen) auch kritisieren sollten und dies, implizit oder explizit, auch immer schon tun. Zu bewerten und zu kritisieren – und das gilt besonders für die sogenannten »posttraditionalen Gesellschaften« – ist Teil dessen, was es bedeutet, eine Lebensform zu teilen und (dabei) mit anderen Lebensformen konfrontiert zu sein. Die Behauptung, der ich in der folgenden Untersuchung nachgehen werde, lautet also: Über Lebensformen lässt sich streiten, und zwar mit Gründen streiten. Mit Lebensformen sind Geltungsansprüche impliziert, die sich nicht folgenlos »einklammern« lassen, selbst wenn es sich hier nicht um letztbegründbare (und in diesem Sinne zwingende) Gründe handelt. Vermittelt...