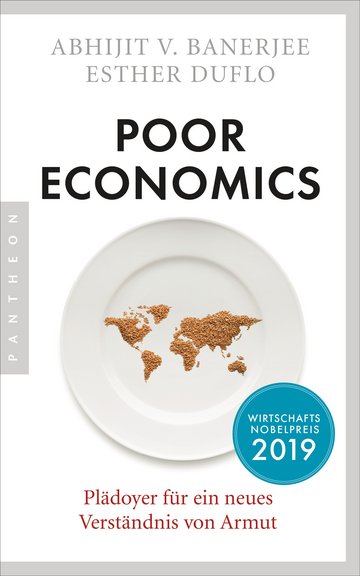Die Ökonomie der Armen
In einem Bilderbuch über Mutter Teresa hatte Esther als Sechsjährige gelesen, in der Stadt, die damals noch Kalkutta hieß, lebten so viele Menschen, dass jedem nur ein Quadratmeter zur Verfügung stehe. Sie stellte sich die Stadt als riesiges Schachbrett vor, mit auf den Boden gezeichneten Feldern von einem auf einen Meter Länge, auf dem die menschlichen Schachfiguren eng aneinandergedrängt hockten. Und sie überlegte, was sie dagegen tun könnte.
Mit vierundzwanzig, als Doktorandin am Massachusetts Institute of Technology (MIT), kam sie zum ersten Mal nach Kalkutta. Als sie mit dem Taxi in die Stadt fuhr, fühlte sie leichte Enttäuschung in sich aufsteigen: Wohin sie auch schaute, war nichts als leerer Raum – Bäume, Grasstreifen, leere Gehwege. Wo war all das Elend, das ihr Kinderbuch so eindringlich dargestellt hatte? Wo waren all die Leute?
Mit sechs Jahren wusste Abhijit genau, wo die Armen wohnten. Sie lebten in den baufälligen Hütten hinter dem Haus seiner Eltern in Kalkutta. Ihre Kinder hatten anscheinend viel Zeit zum Spielen, und sie schlugen ihn in jeder Sportart: Wenn er hinunterging, um mit ihnen Murmeln zu spielen, landeten die Murmeln am Ende immer in den Taschen ihrer zerlumpten Hosen. Er beneidete sie.
Dieser Hang, die Armen auf ein paar Klischees zu reduzieren, existiert genauso lang wie die Armut: Sowohl die Soziologie als auch die Literatur stellt sie abwechselnd als faul oder geschäftstüchtig, als edel oder kriminell, als aufsässig oder ergeben, als hilflos oder selbstgenügsam dar. Kein Wunder, dass die politischen Positionen, die auf dieser Einschätzung der Armen beruhen, in ähnlich schlichte Formeln gefasst werden können: »Freie Märkte für die Armen«, »Die Menschenrechte müssen im Vordergrund stehen«, »Legt erst die Konflikte bei«, »Mehr Geld für die Ärmsten«, »Hilfe von außen verhindert die Entwicklung« und so weiter. In all diesen Vorstellungen steckt ein Körnchen Wahrheit, aber so gut wie nie beschäftigen sie sich mit dem armen Menschen selbst – mit seinen Hoffnungen und Zweifeln, mit seinen Grenzen und Zielen, mit seinen Überzeugungen und Unsicherheiten. Arme treten allenfalls als Figuren in komischen oder tragischen Geschichten auf; solche Leute kann man bewundern oder bemitleiden, aber nicht als Quellen für tiefer gehende Erkenntnisse heranziehen oder danach fragen, was sie meinen, wollen oder tun.
Die Ökonomie der Armut wird nicht selten als unergiebige Ökonomie (poor economy) missverstanden. Weil die Armen nur sehr wenig besitzen, glauben viele, an ihrer wirtschaftlichen Existenz könne nichts interessant sein. Dieses Missverständnis behindert leider die Bekämpfung der globalen Armut: Ein einfaches Problem muss eine einfache Lösung haben. Das Feld der Strategien zur Armutsbekämpfung ist übersät mit den Resten wunderbar einfacher Lösungen, die – o Wunder – nicht funktionierten. Wenn wir vorankommen wollen, müssen wir aufhören, die Armen zu Karikaturen ihrer selbst zu machen. Wir müssen uns die Zeit nehmen, ihr Leben in seiner Komplexität und Vielfalt kennenzulernen und zu verstehen. Genau das haben wir in den vergangenen fünfzehn Jahren versucht.
Wir sind Forscher, und wie die meisten Forscher formulieren wir Theorien und starren gebannt auf Datensätze. Doch unsere Art der Arbeit erforderte es, Monate (wenn auch über Jahre verteilt) »mitten im Leben« zuzubringen, mit den Aktivisten von Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Regierungsbeamten, Gesundheitshelfern, Mikrokreditgebern und in den Dörfern und Stadtvierteln, wo die Armen leben. Überall haben wir Fragen gestellt und Daten gesammelt. Ohne das freundliche Entgegenkommen der Menschen, denen wir begegnet sind, hätten wir dieses Buch nicht schreiben können. Wir wurden immer mit großer Gastfreundlichkeit aufgenommen, obwohl wir meistens unangekündigt irgendwo auftauchten. Geduldig beantworteten unsere Gesprächspartner unsere Fragen, auch wenn sie ihnen manchmal unsinnig erschienen, und viele erzählten uns ihre Lebensgeschichte. 1
Wieder zu Hause an unseren Schreibtischen waren wir gleichermaßen fasziniert und irritiert, wenn wir an diese Geschichten zurückdachten, unsere Daten analysierten und versuchten, all das mit den einfachen Modellen in Übereinstimmung zu bringen, die professionelle Entwicklungsökonomen und politische Entscheidungsträger üblicherweise verwenden, wenn sie sich über das Leben der Armen Gedanken machen. In den meisten Fällen zwangen uns unsere Daten und Erkenntnisse, die Theorien, von denen wir ausgegangen waren, zu korrigieren oder ganz aufzugeben. Aber wir taten das erst, nachdem wir genau verstanden hatten, warum sie nicht tragfähig waren und wie wir sie besser an die tatsächlichen Gegebenheiten anpassen konnten. Das Buch ist das Ergebnis dieses Austauschs, der Versuch, eine stimmige Beschreibung des Lebens armer Leute abzugeben.
Wir haben uns auf die Ärmsten der Armen konzentriert. In den fünfzig Ländern, in denen die meisten Armen leben, liegt die Armutsgrenze im Schnitt bei 16 indischen Rupien pro Person und Tag. Menschen, die von weniger leben müssen, werden auch von den Regierungen ihrer eigenen Länder als arm betrachtet. Nach dem momentanen Wechselkurs entsprechen 16 Rupien etwa 36 US-Cent. Nachdem die Preise in den meisten Entwicklungsländern jedoch niedriger sind als in den USA, müssten die Armen mehr Geld ausgeben, wenn sie zu amerikanischen Preisen einkaufen würden – nämlich 99 US-Cent.2 Wenn Sie eine Idee davon bekommen wollen, wie Arme leben, dann stellen Sie sich vor, Sie hätten für fast den gesamten täglichen Bedarf (ohne die Miete) nicht mehr als 99 US-Cent am Tag zur Verfügung. Das ist nicht leicht, in Indien bekommen Sie dafür etwa 15 kleine Bananen oder drei Pfund Reis minderer Qualität. Kann man davon leben? Im Jahr 2005 taten dies weltweit etwa 865 Millionen Menschen, 13 Prozent der Weltbevölkerung.
Das Verblüffende ist, dass selbst Menschen, die so arm sind, uns in fast allem gleichen. Wir haben dieselben Wünsche und Schwächen; die Armen sind nicht weniger rational als andere, ganz im Gegenteil. Eben weil sie so wenig haben, denken sie oft viel sorgfältiger nach, bevor sie sich für etwas entscheiden: Sie müssen höchst wirtschaftlich denken, um zu überleben. Und doch sind unsere Leben völlig verschieden. Das hat viel mit dem zu tun, was wir in unserem eigenen Leben für selbstverständlich halten, ohne groß darüber nachzudenken.
Wenn Sie mit 99 US-Cent am Tag auskommen müssen, heißt das, dass Sie nur sehr eingeschränkten Zugang zu Information haben, denn Zeitungen, Fernseher, Bücher kosten Geld. Das heißt, von vielem, was für den Rest der Welt Allgemeinwissen ist, haben Sie noch nie gehört, etwa dass eine Impfung Ihr Kind vor Masern schützen kann. Es heißt auch, in einer Welt zu leben, deren Institutionen nicht für jemanden wie Sie gemacht sind. Die meisten armen Menschen beziehen keinen Lohn, geschweige denn, dass sie eine Rentenversicherung hätten, in die automatisch ein Teil davon fließt. Es bedeutet, Entscheidungen über Dinge zu treffen, die mit einer Menge Kleingedrucktem einhergehen, obwohl Sie noch nicht einmal das Großgedruckte richtig lesen können. Was macht jemand, der die Produktinformation einer Krankenversicherung nicht lesen kann, die eine ganze Reihe von Krankheiten mit unaussprechlichen Namen ausschließt? Es bedeutet, wählen zu gehen, obwohl Sie von Ihrem politischen System nicht mehr mitbekommen als nicht eingelöste Wahlversprechen, und es bedeutet, kein Geld zurücklegen zu können, weil die Bank aus Ihren Ersparnissen nicht einmal genug erwirtschaftet, um die entstehenden Verwaltungskosten zu decken. Und so weiter.
Das Beste aus sich zu machen und für die Familie Vorsorge zu treffen, verlangt armen Menschen also viel, viel mehr Erfindungsgeist, Willenskraft und Einsatz ab. Umgekehrt sind es die kleinen Geldbeträge, die kleinen Hindernisse, die kleinen Fehler, über die die meisten von uns locker hinweggehen, die den Armen das Leben schwer machen.
Es ist nicht leicht, der Armut zu entrinnen, aber das Gefühl, es schaffen zu können, und gezielte kleine Hilfen (etwas Information, ein leichter Anstoß) sind manchmal überraschend wirkungsvoll. Andererseits bringen zu hoch gesteckte Erwartungen, fehlende Zuversicht und kleinere Hürden manchmal alles zum Scheitern. Ein Druck auf den richtigen Knopf kann unglaublich viel bewirken – das Problem ist, den richtigen Knopf zu finden. Und natürlich gibt es nicht den einen Knopf, der alle Probleme löst.
Poor Economics ist ein Buch über die ausgesprochen ergiebige Ökonomie, die zutage tritt, wenn man ein Verständnis für das ökonomische Leben der Armen entwickelt. Es ist ein Buch über die Theorien, die uns helfen nachzuvollziehen, was die Armen selbst erreichen können und wofür sie einen Anschub brauchen. Jedes Kapitel dieses Buches beschreibt eine andere Suche nach den zugrunde liegenden Schwierigkeiten und danach, wie sie überwunden werden können. Wir beginnen mit einem Blick auf die elementaren Dinge im Leben von Familien: Was kaufen sie? Gehen die Kinder zur Schule? Was tun sie für ihre Gesundheit oder die von Kindern oder Eltern? Wie viele Kinder möchten sie haben? Und so weiter. Danach gehen wir der Frage nach, wie Märkte und Institutionen für die Armen arbeiten: Können sie Geld leihen, ansparen und sich gegen Risiken versichern? Was tun Regierungen für sie und wann lassen sie sie im Stich? Wir werden immer wieder auf diese grundlegenden Fragen zurückkommen. Gibt es Möglichkeiten für die Armen, ihr Leben zu verbessern, und was hält sie davon ab, es zu tun? Sind es die Kosten am Anfang, oder ist es zwar leicht, damit anzufangen, aber schwer durchzuhalten?...