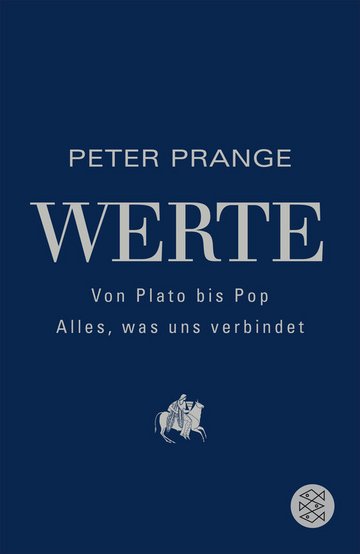Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Der Tod des Fürsten
Juli 1883
Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896–1957) entstammte einem der bedeutendsten sizilianischen Adelsgeschlechter. Seine literarische Karriere begründet er mit seinem einzigen Roman, Der Leopard, den er 1954 innerhalb weniger Monate in seiner römischen Lieblingspasticceria zu Papier brachte. Erst kurz nach seinem Tod erkannte der große italienische Verleger Feltrinelli die Qualität des Buches und machte es zu einem Welterfolg.
Manchmal war er überrascht, daß der Lebens-Wasserbehälter nach den Verlusten so vieler Jahre noch etwas sollte enthalten können. ›Selbst dann nicht, wenn er groß wäre wie eine Pyramide.‹ Ein anderes Mal, oder vielmehr öfter, war er von Stolz erfüllt darüber, daß gleichsam er ganz allein dieses ständige Fliehen bemerkte, während um ihn herum niemand ein Gefühl dafür zu haben schien; und er hatte darin einen Anlaß gefunden, die anderen zu verachten, wie der ältere Soldat den Rekruten verachtet, der sich der Täuschung hingibt, die ihn umschwirrenden Kugeln seien große, summende, harmlose Fliegen. Das sind Dinge, die man – warum, weiß man nicht – niemandem anvertraut; man überläßt es den anderen, sie zu ahnen; und kein Mensch in seiner Umgebung hatte sie je geahnt, keine der Töchter, die ein Jenseits erträumten, das diesem Leben gleich wäre, vollständig versehen mit allem, mit Verwaltung, Köchen und Klöstern; nicht Stella, die, während sie am Brand infolge Zuckerkrankheit elend zugrunde ging, sich trotzdem töricht an dieses Leben voller Qual geklammert hatte. Vielleicht hatte ihn nur Tancredi einen Augenblick verstanden, als er in seiner widerspenstig-ironischen Art zu ihm gesagt hatte: »Großer Onkel, du hofierst den Tod, als wäre er eine schöne Frau.« Jetzt war das Hofieren zu Ende: die Schöne hatte ihr Ja gesagt, die Flucht war beschlossen, das Abteil im Zuge reserviert. Doch nun war die Sache anders, ganz anders. Er saß, die langen Beine in eine Decke gehüllt, in einem Sessel auf dem Balkon des Albergo Trinacria und fühlte, wie das Leben in breiten, drängenden Sturzwellen von ihm fortging, mit einem dem Geiste spürbaren Getöse, das man mit dem Rheinfall hätte vergleichen können. Es war um die Mittagszeit eines Montags Ende Juli, und das Meer von Palermo, dicht, ölig, unbeweglich, weitete sich vor ihm, unwahrscheinlich reglos und flach hingestreckt wie ein Hund, der bestrebt ist, sich vor den Drohungen des Herrn unsichtbar zu machen; aber die Sonne, unverrückbar, senkrecht, stand breitbeinig darüber und peitschte es ohne Erbarmen. Die Stille war vollkommen. Unter dem hohen Licht vernahm Don Fabrizio nur einen einzigen Ton: in seinem Innern den Ton des Lebens, das aus ihm herausbrach.
(…)
Er wartete auf den Klang vom Glöckchen des Viatikums. Er vernahm ihn sehr bald: die Kirche der Pietà war fast gegenüber. Der silberne, nahezu festliche Klang kletterte die Treppen hinauf, brach in den Flur ein, wurde ganz hell, als sich die Tür öffnete: erst kam der Direktor des Albergo, ein dicker Schweizer, der sehr aufgeregt darüber war, daß er einen Sterbenden in seinem Haus habe, und dann trat Pater Balsàmo ein, der Priester, und trug in der vom Lederetui behüteten Hostienkapsel das Sanctissimum. Trancredi und Fabrizietto hoben den Sessel und trugen ihn ins Zimmer zurück; die anderen waren niedergekniet. Don Fabrizio sagte, mehr mit der Gebärde als mit der Stimme: »Weg, weg!« Er wollte beichten. Man tut die Dinge richtig – oder gar nicht. Alle gingen hinaus, aber als er sprechen wollte, merkte er, daß er nicht viel zu sagen hatte: er erinnerte sich einiger bestimmter Sünden, doch sie erschienen ihm so kümmerlich, daß es sich wirklich nicht lohnte, einen würdigen Priester an diesem schwülen Tage damit zu behelligen. Nicht daß er sich ohne Schuld fühlte – aber die Schuld erstreckte sich auf das ganze Leben, nicht auf diese oder jene einzelne Tat; und das zu sagen hatte er nicht mehr die Zeit. Seine Augen drückten wohl eine Verwirrung aus, die der Priester als einen Ausdruck tiefer Reue nahm – wie er es tatsächlich in gewissem Sinne war. Er erhielt die Absolution; sein Kinn, so wenigstens schien es ihm, lehnte auf der Brust, so daß sich der Priester knien mußte, um ihm die Partikel zwischen die Lippen zu schieben. Dann wurden die uralten Silben gemurmelt, die den Weg ebnen, und der Priester zog sich zurück.
Der Sessel wurde nicht mehr auf den Balkon geschleppt. Fabrizietto und Trancredi setzten sich neben ihn, ein jeder hielt eine Hand; der Enkel sah ihn unverwandt an, mit einer Neugier, die an jemandem, der zum erstenmal einem Todeskampf beiwohnt, nur natürlich ist: Neugier – weiter nichts; der da starb, war nicht ein Mensch, es war ein Großvater, und das ist etwas ganz anderes. Tancredi drückte ihm fest die Hand und redete, redete viel, redete heiter: er legte Pläne dar und ließ ihn an ihnen teilnehmen, er kommentierte die politischen Ereignisse; er war Abgeordneter, man hatte ihm die Gesandtschaft in Lissabon versprochen, er kannte viele geheime, ergötzliche Geschichten.
(…)
Tancredi. Gewiß, viel von den Aktiva kam von Tancredi; sein Verständnis, das um so wertvoller war, als es sich ironisch äußerte; die ästhetische Freude, die man empfand, wenn man sah, wie er sich in den Schwierigkeiten des Lebens zurechtfand; die spöttisch-herzliche Art, die genau das Wünschenswerte war. Danach die Hunde: Fufi, der dicke Mops seiner Kindheit, Tom, der ungestüme, zutrauliche Pudel, ein Freund; die sanften Augen von Svelto, die köstliche Tölpelhaftigkeit von Bendicò, die zärtlichen Pfoten von Pop, dem pointer, der ihn in diesem Augenblick unter den Büschen und den Sesseln der Villa suchte und ihn nicht mehr finden würde; ein paar Pferde, diese schon weiter entfernt und fremd. Da waren die ersten Stunden jedesmal, wenn er nach Donnafugata zurückgekehrt war, die Empfindung von Tradition und Dauer, ausgedrückt in Stein und in Wasser; die gleichsam geronnene Zeit; das lustige Flintenknallen einiger Jagden, das freundschaftliche Gemetzel unter Hasen und Rebhühnern, hier und da ein gutes Gelächter mit Tumeo, einige Minuten der Sammlung im Kloster, wo es halb muffig, halb nach Zuckerzeug roch. Noch etwas? Ja, noch etwas – aber das war schon irdischer, Goldkörnchen im Sand: die Augenblicke der Genugtuung, wenn er Dummköpfen scharfe Antworten gegeben hatte; die Zufriedenheit, als er gemerkt hatte, daß in der Schönheit und im Charakter Concettas eine wahre Salina fortlebte; ein paar Momente feuriger Liebe; die Überraschung, als er den Brief von Arago bekam, worin man ihn ganz unmittelbar beglückwünschte zu der Exaktheit der schwierigen Berechnungen des Huxley-Kometen. Und weiter – warum nicht? Die öffentliche Begeisterung, als er an der Sorbonne die Medaille in Empfang nahm; das delikate Gefühl beim Berühren einiger ganz feiner Krawattenseiden, der Duft von manchem mürben Leder; der heitere, die Sinnlichkeit reizende Anblick mancher Frauen, denen man auf der Straße begegnet war, der etwa, die er gestern auf dem Bahnhof in Catania flüchtig gesehen hatte, im Gewühl, in ihrem braunen Reisekleid und den gamsledenen Handschuhen: ihm war es vorgekommen, als suche sie von draußen in dem schmutzigen Abteil sein aufgelöstes Gesicht. Was für ein Geschrei in dem Gewühl! »Belegte Brötchen!« »Ill corriere dell’ isola!« Und dann dieses Hin und Her des müden, atemlosen Zuges … Und diese grausame Sonne bei der Ankunft, diese lügnerischen Gesichter, das Hervorbrechen der stürzenden Wassermassen …
In dem Schatten, der an ihm hochstieg, versuchte er zu rechnen, wie lange er in Wirklichkeit gelebt habe. Sein Hirn konnte mit der einfachen Rechnung nicht mehr fertig werden: drei Monate, zwanzig Tage, eine Gesamtsumme von sechs Monaten, sechs mal acht, vierundachtzig … achtundvierzigtausend … 840000. Er fing sich wieder: ›Ich bin dreiundsiebzig Jahre alt, in Bausch und Bogen werde ich davon gelebt haben, wirklich gelebt, eine Gesamtsumme von zwei … drei höchstens.‹ Und die Schmerzen, die Öde, wie viele Jahre waren das? Unnütz, das mühsam zusammenzuzählen – alles, was übrigbleibt: siebzig Jahre.
Er spürte, daß seine Hand die beiden nicht mehr drückte. Tancredi erhob sich eilig und ging hinaus … Jetzt brach nicht mehr ein Fluß aus ihm heraus, sondern ein Ozean, stürmisch, voller Schaum und entfesselter Sturzwellen …
Das Herz hatte wohl wieder ausgesetzt, er merkte plötzlich, daß er auf dem Bett lag. Jemand fühlte ihm den Puls; vom Fenster her blendete ihn der erbarmungslose Widerschein des Meeres. Im Zimmer war ein pfeifender Laut zu vernehmen: sein Röcheln; aber er selbst wußte es nicht. Um ihn ein kleines Gedränge, eine Gruppe fremder Menschen, die ihn mit furchtsamem Ausdruck unverwandt ansahen. Ganz allmählich erkannte er sie: Concetta, Francesco Paolo, Carolina, Tancredi, Fabrizietto. Der, der ihm den Puls fühlte, war der Doktor Cataliotti; er meinte, er lächle diesem zu, um ihn willkommen zu heißen, aber keiner konnte es gewahr werden: alle, alle, außer Concetta, weinten, auch Trancredi; dieser sagte: »Onkel, lieber großer Onkel!«
Plötzlich schob sich durch die Gruppe eine junge Frau; schlank, in einem braunen Reisekleid mit weiter tournure, in einem Strohhut, geschmückt mit einem Schleier mit kleinen Kügelchen, der die schelmische Anmut des Gesichts nicht verhüllen konnte. Sie drückte leise mit dem Händchen im Gamslederhandschuh die Ellbogen zweier Weinender auseinander, sie entschuldigte sich, sie kam näher. Sie war es,...